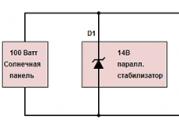Die Geschichte von Akimushkins Spuren von unsichtbaren Tieren. Spuren unsichtbarer Bestien. Ein Fluss, in dem man nicht schwimmen kann
Akimuschkin I
Spuren unsichtbarer Bestien
Igor Iwanowitsch Akimuschkin
SPUREN VON UNSICHTBAREN TIEREN
Riesenvögel lebten auf der Erde - Wachstum mehr Elefant! Ein Wassermonster, das Flusspferde verschlingt, lebt in den Wäldern des Kongo... Zoologen einer Expedition in Kamerun wurden von einem Pterodaktylus angegriffen... Der Liner Saita Clara kollidierte mit einer Seeschlange im Ozean, und das norwegische Schiff Brunsvik wurde angegriffen ein Riesenkalmar...
Was ist hier wahr, was ist Fiktion?
Wenn Sie sich für zoologische Abenteuer und verborgene Geheimnisse des Dschungels interessieren, werden Sie das Buch „Spuren seltsamer Bestien“ mit Interesse lesen. Sie erfahren etwas über Drachen von Komodo und über die schreckliche Nunda (eine Katze so groß wie ein Esel!), über den fabelhaften Phönixvogel und darüber, wie viele neue Tiere und Vögel im letzten halben Jahrhundert von Wissenschaftlern entdeckt wurden und welche anderen Unbekannte Kreaturen verstecken sich in der Wildnis des Waldes und den Tiefen des Meeres unseres Planeten.
EINLEITUNG
Im September 1957 untersuchten japanische Zoologen ein von Walfängern gefangenes Meerestier. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Bestie um einen Gürtelzahnwal einer der Wissenschaft unbekannten Art handelte. Keith!
Dieser Fund ist symbolisch. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als die Menschheit, nachdem sie Ultrahochgeschwindigkeitsraketen geschaffen hatte, mutig in die Außenwelt zu Hause auf der Erde stürmte, wurden plötzlich solche Versehen von "unbemerkten" Walen entdeckt! Wie man sieht, ist die Tierwelt unseres Planeten noch lange nicht so gut erforscht, wie es gemeinhin behauptet wird. Im letzten halben Jahrhundert hat die Presse die Leser wiederholt über unbekannte Vögel, Tiere oder Fische informiert, die irgendwo in der Wildnis des Regenwaldes oder in den Tiefen des Ozeans gefunden wurden. Und wie viele große zoologische Entdeckungen sind von der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen worden! Nur Spezialisten kennen sie.
Wie lässt sich erklären, dass die Natur den Naturforschern immer noch unerwartete Überraschungen bietet?
Tatsache ist, dass es viele schwer zugängliche Orte auf der Erde gibt, die einer Untersuchung noch fast nicht zugänglich sind. Einer davon ist der Ozean. Fast drei Viertel Erdoberfläche vom Meer bedeckt. Etwa vier Millionen Quadratkilometer Meeresboden sind in ungeheuren Tiefen von über sechstausend Metern begraben. Ihre düsteren Grenzen, künstliche Fanggeräte, wurden erst ein paar Dutzend Mal angegriffen. Rechnen Sie nach: ungefähr eine Tiefseeschleppnetzfischerei pro 40.000 Quadratkilometer Meeresboden!
Die Inkommensurabilität dieser Zahlen überzeugt uns mehr als alle Worte davon, dass die Tiefen des Ozeans bis heute nicht wirklich erforscht wurden.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass buchstäblich jedes Schleppnetz, das auf eine beträchtliche Tiefe abgesenkt wird, notwendigerweise Tiere vom Meeresgrund mit sich bringt, die Fachleuten unbekannt sind.
1952 fischten amerikanische Ichthyologen im Golf von Kalifornien und fingen selbst hier mindestens 50 ihnen unbekannte Fischarten. Aber ein wirklich endloses Land der unerwartetsten Funde wurde von sowjetischen Wissenschaftlern eröffnet, die mit Hilfe von in die Tiefen des Ozeans eindrangen die neueste Ausrüstung Forschungsschiff "Vityaz". Wo auch immer sie arbeiten mussten: sowohl im Pazifik als auch in Indische Ozeane entdeckten sie unbekannte Fische, Tintenfische, Mollusken, Würmer.
Sogar auf den Kurilen, die zuvor mehr als eine Expedition besucht hatte, machten sowjetische Wissenschaftler (S. K. Klumov und seine Mitarbeiter) unerwartete Entdeckungen. Auf der Insel Kunaschir wurden giftige Schlangen gefunden. Davor glaubte man, dass auf den Kurilen nur ungiftige Schlangen gefunden wurden. Hier wurden bisher unbekannte Molche, Laubfrösche und Landegel der ganz besonderen Art gefunden.
Zoologen "Vityaz" extrahierten aus dem Meeresboden noch ungewöhnlichere Kreaturen - fantastische Gonophoren. Dies sind Tiere, die die Natur "vergessen" hat, mit den lebensnotwendigsten Organen auszustatten - Mund und Darm!
Wie essen sie?
Auf die unglaublichste Art und Weise - mit Hilfe von Tentakeln. Die Tentakel fangen Nahrung auf, verdauen sie und nehmen die nahrhaften Säfte auf, die durch die Blutgefäße in alle Körperteile fließen.
Bereits 1914 wurde der erste Vertreter der Pogonophora vor der Küste Indonesiens gefangen. Der zweite wurde vor 29 Jahren in unserem Ochotskischen Meer gefunden. Aber lange Zeit konnten Wissenschaftler keinen geeigneten Platz für diese seltsamen Kreaturen in der wissenschaftlichen Klassifizierung von Wildtieren finden.
Nur die Studien des "Vityaz" halfen, ziemlich umfangreiche Sammlungen der einzigartigsten Kreaturen zu sammeln. Nach dem Studium dieser Sammlungen kamen Zoologen zu dem Schluss, dass Pogonophoren keiner der neun größten zoologischen Gruppen - den sogenannten Arten * des Tierreichs - angehören. Pogonophoren bildeten einen besonderen, zehnten Typ. Ihre Struktur ist so ungewöhnlich.
*Die meisten Zoologen teilen die Tierwelt in folgende Arten ein:
1) Protozoen (Amöben, Ciliaten und andere Einzeller);
3) Hohltiere (Quallen, Korallen);
5) wurmartig (Bryozoen, Brachiopoden);
6) Weichtiere (Schnecken, Muscheln, Tintenfische);
7) Arthropoden (Krebse, Spinnen, Insekten);
8) Stachelhäuter (Seesterne, Seeigel) und
9) Akkordate (Ascidien, Fische, Frösche, Schlangen, Vögel, Säugetiere).
Pogonophoren kommen heute in allen Ozeanen vor, sogar in der Arktis. Sie sind auf der ganzen Welt verbreitet und auf dem Meeresgrund offenbar gar nicht selten. A. V. Ivanov, ein Leningrader Zoologe, dem die Wissenschaft die gründlichsten Studien über Pogonophora verdankt, schreibt, dass diese Tiere in vielen ihrer Lebensräume äußerst häufig vorkommen. "Schleppnetze bringen viele bevölkerte und leere Pogonophor-Röhren hierher, die den Schleppnetzsack verstopfen und sogar am Rahmen und Kabel hängen bleiben."
Warum fielen bis vor kurzem so viele Kreaturen nicht in die Hände von Meeresforschern? Und es ist nicht schwer, sie zu fangen: Pogonophoren führen einen bewegungslosen Lebensstil.
Ja, weil sie nicht mitbekommen haben, dass Wissenschaftler gerade erst anfangen, wirklich in die Tiefen der Ozeane und Meere vorzudringen. Natürlich erwarten uns hier viele der erstaunlichsten Entdeckungen. Bisher wurde nur ein kleiner Teil der Meerestiere untersucht. Die größten und beweglichsten Bewohner der Tiefe sind mit den üblichen Werkzeugen von Fischerei- und Expeditionsschiffen überhaupt nicht zu fangen. Schleppnetze, Netze, Netze sind dafür einfach nicht geeignet. Manche Forscher sagen deshalb: „Im Ozean ist alles möglich!“
Es gibt einen anderen Ort auf der Erde, an dem sich dem Naturforscher von den ersten Schritten an vielversprechende Möglichkeiten eröffnen. Aber seine Geheimnisse zu durchdringen ist nicht einfacher, als in den Abgrund des Ozeans einzudringen. Nicht Tiefen und nicht einmal transzendente Höhen schützen diesen Ort, sondern ganz andere Hindernisse. Es gibt sehr viele von ihnen, und sie sind alle gefährlich.
Einführung
Im September 1957 untersuchten japanische Zoologen ein von Walfängern gefangenes Meerestier. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Bestie um einen Gürtelzahnwal einer der Wissenschaft unbekannten Art handelte. Keith!
Dieser Fund ist symbolisch. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als die Menschheit, nachdem sie ultraschnelle Raketen geschaffen hatte, mutig in die Außenwelt zu Hause auf der Erde stürmte, wurden solche Versehen plötzlich entdeckt - "unbemerkte" Wale! Wie man sieht, ist die Tierwelt unseres Planeten noch lange nicht so gut erforscht, wie man gemeinhin behauptet. Im letzten halben Jahrhundert hat die Presse die Leser wiederholt über unbekannte Vögel, Tiere oder Fische informiert, die irgendwo in der Wildnis des Regenwaldes oder in den Tiefen des Ozeans gefunden wurden. Und wie viele große zoologische Entdeckungen sind von der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen worden! Nur Spezialisten kennen sie.
Wie lässt sich erklären, dass die Natur den Naturforschern immer noch unerwartete Überraschungen bietet?
Tatsache ist, dass es auf der Erde viele schwer zugängliche, noch fast unmöglich zu erforschende Orte gibt. Einer davon ist der Ozean. Fast drei Viertel der Erdoberfläche sind vom Meer bedeckt. Etwa vier Millionen Quadratkilometer Meeresboden sind in ungeheuren Tiefen von über sechstausend Metern begraben. Ihre düsteren Grenzen wurden nur ein paar Dutzend Mal von künstlichen Fanggeräten überfallen. Rechnen Sie nach: ungefähr eine Tiefseeschleppnetzfischerei pro 40.000 Quadratkilometer Meeresboden!
Die Inkommensurabilität dieser Zahlen überzeugt uns mehr als alle Worte davon, dass die Tiefen des Ozeans bis heute nicht wirklich erforscht wurden.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass buchstäblich jedes Schleppnetz, das auf eine beträchtliche Tiefe abgesenkt wird, notwendigerweise Tiere vom Meeresgrund mit sich bringt, die Fachleuten unbekannt sind.
1952 fischten amerikanische Ichthyologen im Golf von Kalifornien und fingen selbst hier mindestens 50 ihnen unbekannte Fischarten. Aber ein wirklich endloses Land der unerwartetsten Funde wurde von sowjetischen Wissenschaftlern entdeckt, die mit Hilfe der neuesten Ausrüstung des Forschungsschiffs Vityaz in die Tiefen des Ozeans vordrangen. Wo immer sie arbeiten mussten: Sowohl im Pazifik als auch im Indischen Ozean entdeckten sie unbekannte Fische, Tintenfische, Weichtiere und Würmer.
Sogar auf den Kurilen, die zuvor mehr als eine Expedition besucht hatte, machten sowjetische Wissenschaftler (S. K. Klumov und seine Mitarbeiter) unerwartete Entdeckungen. Auf der Insel Kunaschir wurden giftige Schlangen gefunden. Davor glaubte man, dass auf den Kurilen nur ungiftige Schlangen gefunden wurden. Hier wurden bisher unbekannte Molche, Laubfrösche und Landegel der ganz besonderen Art gefunden.
Die Zoologen der Vityaz haben noch ungewöhnlichere Kreaturen vom Meeresgrund geborgen - fantastische Pogonophoren. Dies sind Tiere, die die Natur „vergessen“ hat, mit den lebensnotwendigsten Organen auszustatten - Mund und Darm!
Wie essen sie?
Auf die unglaublichste Art und Weise - mit Hilfe von Tentakeln. Die Tentakel fangen Nahrung auf, verdauen sie und nehmen die nahrhaften Säfte auf, die durch die Blutgefäße in alle Körperteile fließen.
Bereits 1914 wurde der erste Vertreter der Pogonophora vor der Küste Indonesiens gefangen. Der zweite wurde vor 29 Jahren in unserem Ochotskischen Meer gefunden. Aber lange Zeit konnten Wissenschaftler keinen geeigneten Platz für diese seltsamen Kreaturen in der wissenschaftlichen Klassifizierung von Wildtieren finden.
Nur die Studien der Vityaz halfen, ziemlich umfangreiche Sammlungen der einzigartigsten Kreaturen zu sammeln. Nach dem Studium dieser Sammlungen kamen Zoologen zu dem Schluss, dass Pogonophoren keiner der neun größten zoologischen Gruppen - den sogenannten Arten des Tierreichs - angehören. Pogonophoren bildeten einen besonderen, zehnten Typ. Ihre Struktur ist so ungewöhnlich.
Pogonophoren kommen heute in allen Ozeanen vor, sogar in der Arktis. Sie sind auf der ganzen Welt verbreitet und auf dem Meeresgrund offenbar gar nicht selten. A. V. Ivanov, ein Leningrader Zoologe, dem die Wissenschaft die gründlichsten Studien über Pogonophora verdankt, schreibt, dass diese Tiere in vielen ihrer Lebensräume äußerst häufig vorkommen. „Schleppnetze bringen viele gefüllte und leere Pogonophor-Röhren hierher, verstopfen den Schleppnetzsack und hängen sogar am Rahmen und Kabel.“
Warum fielen bis vor kurzem so viele Kreaturen nicht in die Hände von Meeresforschern? Und es ist nicht schwer, sie zu fangen: Pogonophoren führen einen bewegungslosen Lebensstil.
Ja, weil sie nicht mitbekommen haben, dass Wissenschaftler gerade erst anfangen, wirklich in die Tiefen der Ozeane und Meere vorzudringen. Natürlich erwarten uns hier viele der erstaunlichsten Entdeckungen. Bisher wurde nur ein kleiner Teil der Meerestiere untersucht. Die größten und beweglichsten Bewohner der Tiefe sind mit den üblichen Werkzeugen von Fischerei- und Expeditionsschiffen überhaupt nicht zu fangen. Schleppnetze, Netze, Netze sind dafür einfach nicht geeignet. Manche Forscher sagen deshalb: „Im Ozean ist alles möglich!“
Es gibt einen anderen Ort auf der Erde, an dem sich dem Naturforscher von den ersten Schritten an vielversprechende Möglichkeiten eröffnen. Aber seine Geheimnisse zu durchdringen ist nicht einfacher, als in den Abgrund des Ozeans einzudringen. Nicht Tiefen und nicht einmal transzendente Höhen schützen diesen Ort, sondern ganz andere Hindernisse. Es gibt sehr viele von ihnen, und sie sind alle gefährlich.
Es geht um den Tropenwald. Die raue Antarktis ist berühmt für ihre Unzugänglichkeit. Aber in seinem Schnee kann man sich, obwohl mit unglaublichen Schwierigkeiten, in speziell ausgestatteten Fahrzeugen fortbewegen. Im Regenwald bleibt jeder Geländewagen gleich am Anfang stecken.
Ein Mensch kann hier nur mit den Transportmitteln, die ihm die Natur gegeben hat, das Ziel erreichen. Welche Prüfungen ihm bevorstehen, erfahren wir im nächsten Kapitel.
Schwarze Albträume und „weiße Flecken“ des Dschungels
Die Schrecken der „Grünen Hölle“
„Jemand sagte“, schreibt Arkady Fidler, „dass es für eine Person, die den Dschungel betritt, nur zwei angenehme Tage gibt. Der erste Tag, an dem er, geblendet von ihrer bezaubernden Pracht und Macht, glaubt, in den Himmel gekommen zu sein, und der letzte Tag, an dem er, dem Wahnsinn nahe, aus dieser grünen Hölle flieht.
Warum ist der Tropenwald so schrecklich?
Stellen Sie sich einen riesigen Ozean aus riesigen Bäumen vor. Sie wachsen so eng zusammen, dass sich ihre Spitzen zu einem undurchdringlichen Gewölbe verflechten.
Fantasievolle Schlingpflanzen und Rattans verflochten den ohnehin schon undurchdringlichen Dschungel mit einem dichten Netz. Baumstämme, knotige Rebententakel sind mit Moosen, riesigen Flechten bewachsen. Moos ist überall - sowohl auf verrottenden Stämmen als auch auf winzigen, mit einem "Taschentuch" versehenen Landstücken, die nicht von Bäumen besetzt sind, und in schlammigen Bächen und Gruben, die mit dicker schwarzer Gülle gefüllt sind.
Nirgends ein Grasbüschel. Überall Moose, Pilze, Farne, Schlingpflanzen, Orchideen und Bäume; die Bäume sind monströse Riesen und schwache Zwerge. Alle drängen sich im Kampf ums Licht, klettern aufeinander, verflechten sich, winden sich hoffnungslos, bilden ein unwegsames Dickicht.
Ringsum herrscht eine graugrüne Dämmerung. Es gibt keinen Sonnenaufgang, keinen Sonnenuntergang, keine Sonne selbst am Himmel.
Kein Wind. Nicht einmal der leiseste Atemzug. Die Luft ist regungslos wie in einem Gewächshaus, gesättigt mit Wasser- und Kohlendioxiddämpfen. Es riecht nach Fäulnis. Die Feuchtigkeit ist unglaublich - bis zu 90-100 % relative Luftfeuchtigkeit!

Und die Hitze! Das Thermometer zeigt tagsüber fast immer 40°C über Null an. Heiß, stickig, feucht! Sogar die Bäume, ihre harten, wie Wachs, Blätter waren mit "Schweiß" bedeckt - große Tropfen eingedickten Feuchtigkeitsdampfes. Tropfen laufen übereinander, fallen von Blatt zu Blatt in einem unaufhörlichen Regen, Tropfen klingen überall im Wald.
Nur am Fluss kann man frei atmen. Nachdem er eine Bresche in den monströsen Haufen lebender und toter Bäume geschlagen hat, bringt der Fluss Kühle und Frische in den muffigen Abgrund der Wildnis.

Deshalb gingen alle Expeditionen, die in die Wildnis des Regenwaldes vordrangen, hauptsächlich entlang der Flüsse und entlang ihrer Ufer. Selbst die Bambuti-Pygmäen, die allem Anschein nach besser an das Leben in der Wildnis des Waldes angepasst sind als andere Völker, vermeiden es, sich weit von den Flusstälern, diesen „Autobahnen“ des Regenwaldes, zu entfernen. Auch wandernde, sogenannte Waldindianer, wie der Stamm der Campa, kommen nicht weit in die schreckliche "Selva". Bei ihren Bewegungen durch die Wälder des Amazonas folgen sie im Allgemeinen den Flüssen und Waldkanälen, die ihnen als Orientierungspunkte dienen.

In den entlegensten Ecken des Regenwaldes hat noch kein menschlicher Fuß einen Fuß gesetzt.
Und diese "Ecken" sind nicht so klein. Dreitausend Kilometer landeinwärts, von Guinea bis zu den Gipfeln von Rwenzori, erstrecken sich die tropischen Wälder Afrikas in einer ununterbrochenen Anordnung. Ihre durchschnittliche Breite beträgt etwa tausend Kilometer. Die Länge der Amazonaswälder ist sogar noch bedeutender - über dreitausend Kilometer von Ost nach West und zweitausend Kilometer von Nord nach Süd - sieben Millionen Quadratkilometer, zwei Drittel Europas! Was ist mit den Wäldern von Borneo, Sumatra und Neuguinea? Ungefähr 14 Millionen Quadratkilometer Land auf unserem Planeten sind von undurchdringlichen Walddschungeln besetzt, düster, stickig, feucht, in deren grüner Dämmerung "Wahnsinn und Schrecken lauern".
O Selva, Frau des Schweigens, "Mutter der Einsamkeit und Nebel"!
„Welches böse Schicksal hat mich in dein grünes Gefängnis gesperrt? Das Zelt deines Blattwerks ist wie ein riesiges Gewölbe für immer über meinem Kopf ... Lass mich gehen, oh Eelva, aus deinem krankheitsverursachenden Zwielicht, vergiftet vom Atem der Kreaturen, die in der Hoffnungslosigkeit deiner Größe quälen. Du wirkst wie ein riesiger Friedhof, auf dem du selbst in Verfall verwandelst und wiedergeboren wirst ...
Wo ist die Poesie abgeschiedener Haine, wo sind Schmetterlinge wie durchsichtige Blumen, magische Vögel, melodische Bäche? Die erbärmliche Phantasie von Dichtern, die nur häusliche Einsamkeit kennen.

Keine verliebten Nachtigallen, keine Versailler Parks, keine sentimentalen Panoramen! Hier ist das eintönige Keuchen von Kröten, wie das Keuchen von Menschen, die an Wassersucht leiden, die Wildnis von ungeselligen Hügeln, faulige Altwasser an Waldflüssen. Hier übersäen fleischfressende Pflanzen den Boden mit toten Bienen; ekelhafte Blumen schrumpfen in sinnlichem Zittern, und ihr süßer Geruch berauscht sie wie ein Zaubertrank; der Flaum der heimtückischen Schlingpflanze blendet Tiere, die Pringamosa verbrennt die Haut, die Kuruhu-Frucht sieht außen aus wie eine Regenbogenkugel, aber innen ist sie wie ätzende Asche; wilde Trauben verursachen Durchfall und Nüsse - Bitterkeit selbst ...
Selva, jungfräulich und blutrünstig-grausam, macht einen Menschen besessen von dem Gedanken an eine drohende Gefahr ... Die Sinne verwirren den Verstand: Das Auge berührt, der Rücken sieht, die Nase erkennt den Weg, die Beine rechnen und das Blut schreit laut : "Rennen Rennen!"
Ich kenne keine aussagekräftigere Beschreibung des deprimierenden Eindrucks, den ein Urwald auf einen Menschen macht! Der Autor dieser Passage, der Kolumbianer Jose Rivera, kannte die „blutrünstige, grausame Selva“ gut. Er war an der Arbeit der gemischten Grenzkommission zur Beilegung des Streits zwischen Kolumbien und Venezuela beteiligt, verbrachte viel Zeit im Urwald des Amazonas-Tieflandes und erlebte all seine Schrecken.

Der Kontrast zwischen dieser düsteren Beschreibung des Regenwaldes und der Freude vor seinen Schönheiten, die man oft auf den Seiten der Abenteuerliteratur antrifft, ist frappierend. Ehrlich gesagt sind wir eher an begeisterte Geschichten über die Natur der Tropen gewöhnt. Wenn wir uns einen Regenwald vorstellen, erinnern wir uns normalerweise an Bilder der fabelhaften Pracht der unberührten Natur: ein bizarres Geflecht aus Ranken, riesigen und leuchtenden Blumen, funkelnd wie Edelsteine, Schmetterlinge und Kolibris, bemalt wie Christbaumschmuck, Papageien und Eisvögel. Überall strahlende Sonne, wunderbare Farben, Animation und klangvolle Triller. Schönheit ist bezaubernd!
So ist es: In allem gibt es einen Abgrund an Schönheit, aber auf dieser Erde voller Leben sollte man weder liegen noch sitzen. Du kannst nur in Bewegung bleiben.

„Versuchen Sie“, schreibt der Afrikaforscher Stanley, „legen Sie Ihre Hand auf einen Baum oder strecken Sie sich auf den Boden, setzen Sie sich auf einen abgebrochenen Ast und Sie werden begreifen, welche Macht der Aktivität, welche energische Bosheit und welche zerstörerische Gier Sie umgeben. Öffnen Sie ein Notizbuch - sofort landen ein Dutzend Schmetterlinge auf der Seite, eine Biene wirbelt über Ihrer Hand, andere Bienen streben danach, Sie direkt ins Auge zu stechen, eine Wespe summt vor Ihrem Ohr, eine riesige Bremse huscht vor Ihrer Nase, und ein ganzer Schwarm Ameisen kriecht dir zu Füßen: Vorsicht! Die Vorhut ist bereits aufgestanden, sie klettert schnell hinauf, nur für den Fall, dass sie ihre scharfen Kiefer in deinen Hinterkopf rammen ... Oh, wehe, wehe!
Unter anderen „Problemen“ erwähnt dieser Forscher die Pharaonenlaus oder, in der Landessprache, den Jigger. Sie legt ihre Eier unter ihren großen Zehennagel. Seine Larven breiten sich im ganzen Körper aus und "verwandeln ihn in eine Ansammlung von eitrigem Schorf".
Ein kleiner Käfer geht auch unter die Haut und sticht, genau wie eine Nadel. Überall gibt es große und kleine Zecken und Landegel, die armen Reisenden das Blut aussaugen, und davon sei „schon wenig übrig“. Unzählige Wespen stechen so, dass sie einen Menschen in den Wahnsinn treiben, und wenn sie sich mit der ganzen Herde stürzen, dann in den Tod. Die Tigerschnecke fällt von den Zweigen und hinterlässt eine "giftige Spur ihrer Präsenz auf der Haut Ihres Körpers, sodass Sie sich vor Schmerzen winden und mit einer guten Obszönität schreien". Rote Ameisen, die nachts das Lager angreifen, lassen niemanden schlafen. Von den Bissen schwarzer Ameisen "erfährt man die Qualen der Hölle". Ameisen sind überall! Sie kriechen unter die Kleidung, fallen ins Essen. Schlucken Sie ein halbes Dutzend davon - und "die Schleimhäute des Magens werden geschwürig sein".
Legen Sie Ihr Ohr an den Stamm eines umgestürzten Baumes oder einen alten Baumstumpf. Hörst du das Rumpeln und Zwitschern im Inneren?
Sie sind beschäftigt, summen, fressen sich gegenseitig unzählige Insekten und natürlich Ameisen, Ameisen verschiedener Rassen und Größen. Die Ameisen, die in diesem „Reich des Grauens“ leben, verursachen nicht nur mit ihren Bissen unsägliches Leid. Auf dem Boden, der mit verwesenden Baumkörpern und Moosen übersät ist, zwischen den giftigen Dämpfen der Amazonas-Sümpfe, streifen Millionen von Horden von Etsitons umher, die lokal „Tambocha“ genannt werden. Als Zeichen der großen Gefahr ertönen die unheilvollen Schreie der Ameisenbären in der Wolkenstein, die alle Lebewesen vor dem Nahen des "Schwarzen Todes" warnen. Große und kleine Raubtiere, Insekten, Waldschweine, Reptilien, Menschen – sie alle fliehen panisch vor den marschierenden Kolonnen der Aetonen. Viele Forscher haben über diese gefräßigen Kreaturen geschrieben. Aber die beste Beschreibung gehört wieder José Rivera:
„Sein Schrei war schrecklicher als der Schrei, der den Beginn des Krieges ankündigte:
Ameisen! Ameisen!
Ameisen! Das bedeutete, dass die Menschen sofort aufhören sollten zu arbeiten, ihre Häuser verlassen, sich durch Feuer zurückziehen, irgendwo Schutz suchen sollten. Es war eine Invasion der blutrünstigen Tambocha-Ameisen. Sie verwüsten weite Räume und rücken mit einem Lärm vor, der an das Brüllen eines Feuers erinnert. Ähnlich flügellosen Wespen mit rotem Kopf und dünnem Körper erschrecken sie durch ihre Anzahl und ihre Gefräßigkeit. Eine dicke, stinkende Welle sickert in jedes Loch, in jede Ritze, in jede Mulde, ins Laub, in Nester und Bienenstöcke, verschlingt Tauben, Ratten, Reptilien, schlägt Menschen und Tiere in die Flucht ...
Nach ein paar Augenblicken war der Wald von einem dumpfen Geräusch erfüllt, wie das Rauschen von Wasser, das durch einen Damm bricht.
Oh mein Gott! Ameisen!
Dann erfasste ein Gedanke alle: gerettet zu werden. Sie zogen Blutegel den Ameisen vor und suchten Zuflucht in einem kleinen Tümpel, in das sie bis zum Hals eintauchten.
Sie sahen, wie die erste Lawine vorbeizog. Wie die weit verstreute Asche eines Feuers plumpsten Horden von Kakerlaken und Käfern in den Sumpf, und seine Ufer waren mit Spinnen und Schlangen bedeckt, und Menschen störten das verrottete Wasser und verscheuchten Insekten und Tiere. Die Blätter brodelten wie ein kochender Kessel. Das Gebrüll der Invasion ging über die Erde; die Bäume waren in eine schwarze Hülle gehüllt, eine bewegliche Hülle, die unbarmherzig höher und höher stieg, Blätter abbrach, Nester leerte, in Mulden kletterte.
Ein Fluss, in dem man nicht schwimmen kann
Auf den weichen Polstern aus smaragdgrünen Moosen, die den Boden bedecken, kann man sich in der „schrecklichen Selva“ ohne Vorsichtsmaßnahmen weder hinsetzen noch hinlegen. Es ist unmöglich, hier ohne großes Risiko zu schwimmen. Erschöpfende Hitze treibt die Bewohner der Wildnis in den Schatten der Flusskühle. Aber die Angst vor den Gefahren des großen Flusses lässt sie hastig den Rückzug antreten und ihren Durst kaum mit ein paar Schlucken stillen.
Zahlreiche Krokodile und Wasserboas sind noch nicht die gefährlichsten Kreaturen, die im Amazonas und seinen unzähligen Nebenflüssen leben.
Hier gefunden erstaunlicher Fischähneln riesigen fetten Würmern. Das sind Zitteraale. Sie verstecken sich am Grund stiller Nebengewässer und werden von einem Menschen oder einem Tier gestört und werfen Blitze in alle Richtungen – eine elektrische Entladung nach der anderen blitzt im Fluss auf. Die Spannung im Moment der Entladung des "elektrischen Fisches" kann 500 Volt erreichen! Eine Person, die einen elektrischen Riss erhalten hat, kommt nicht sofort zur Besinnung. Und es gab Fälle, in denen Menschen in einer flachen Furt ertranken und auf eine verärgerte Gruppe Zitteraale stießen.
Leben Sie im großen Amazonas und giftigen Stachelrochen - typische Meeresbewohner, wie es scheint. Außer im Amazonas findet man sie in keinen Flüssen mehr, sondern nur noch in den Meeren.
Der Araya-Stachelrochen, wie ihn die Brasilianer nennen, hat zwei gezackte, giftige Stacheln an seinem Schwanz. Es ist sehr schwierig, einen im Sand vergrabenen Stachelrochen zu bemerken. Nach einem Schlag mit Stilettos springt eine Person, angetrieben von unerträglichen Schmerzen, wie eine feurige Peitsche aus dem Wasser. Und dann fällt er in den Sand, blutet und verliert das Bewusstsein. Es wird gesagt, dass Wunden von vergifteten Araya-Stilettos größtenteils tödlich sind.
Aber nicht der Araya-Stachelrochen – das gefährlichste Flusstier des Amazonas. Und nicht die Haie, die hierher aus dem Ozean schwimmen und bis an die Spitze des großen Flusses gelangen.
Der wahre Albtraum dieser Orte sind zwei kleine Fische: Pirayah und Candiru. Wo sie in großer Zahl anzutreffen sind, wagt sich kein einziger Mensch bei unerträglichster Hitze auch nur knietief ins Wasser.
Piraia ist nicht größer als eine große Karausche, aber ihre Zähne sind scharf wie ein Rasiermesser. Ein Piraya kann sofort einen fingerdicken Stock beißen und reißt einen Finger ab, wenn eine Person ihn versehentlich in der Nähe des "roten" Piraya ins Wasser steckt.
Pirayas greifen in Herden an, reißen Fleischstücke aus dem Körper eines schwimmenden Tieres und nagen das Tier in wenigen Minuten bis auf die Knochen ab. Ein Wildschwein, das einem Jaguar entkommt, springt in den Fluss. Sie schafft es, nur ein Dutzend Meter zu schwimmen – dann tragen die Wellen ihr blutiges Skelett. Blutrünstige Fische, die Fleischreste von den Knochen reißen, stoßen mit ihren stumpfen Schnauzen dagegen, und das leblose Gerippe eines gerade noch kraftstrotzenden Tieres tanzt einen fürchterlichen Totentanz über dem Wasser.
Es kommt vor, dass ein starker Stier, der im Fluss von Pirayas angegriffen wird, es schafft, an Land zu springen: Er sieht aus wie ein gehäuteter Kadaver!
Ein weiterer gefährlicher Fisch im Amazonas ist der Candiru oder Carnero, der winzig ist und wie ein Wurm aussieht. Seine Länge beträgt sieben bis fünfzehn Zentimeter, seine Dicke nur wenige Millimeter. Candiru klettert im Handumdrehen in die natürlichen Öffnungen am Körper einer badenden Person und beißt von innen in ihre Wände. Es ist unmöglich, es ohne chirurgischen Eingriff herauszuziehen.
Elgot Lange, der zwölf abenteuerliche Monate in den Amazonaswäldern lebte, erzählt, dass es die Angewohnheit der Waldbewohner war, aus Angst vor dem Candiru nur in speziellen Becken zu baden. Ein Holzsteg ist tief über dem Wasser gebaut. In der Mitte ist ein Fenster durchgeschnitten. Durch sie schöpft der Badende mit einer Nussschale Wasser und übergießt sich nach eingehender Prüfung.
Nichts zu sagen - ein lustiges Leben!
Es ist gefährlich, tagsüber zu schlafen!
Viele Anfänger in der Wolkenstein haben teuer dafür bezahlt, hier mitten am Tag für ein oder zwei Stunden ein Nickerchen zu machen. Aus Angst vor Ameisen ließen sich Reisende in Hängematten nieder. Aber leider! Sie haben die grünen Fliegen "Varega" vergessen. Ein schlafender Mensch ist für sie ein Glücksfall: Varega-Fliegen legen ihre Eier in seine Nase und Ohren. Nach einigen Tagen schlüpfen Larven aus den Eiern und beginnen, eine lebende Person zu fressen. Sie entstellen das Gesicht, nagen tiefe Gänge unter die Haut in die Gesichtsmuskeln. Meistens fressen sie den Gaumen auf, und wenn es viele Larven gibt, fressen sie den größten Teil des Gesichts auf und die Person stirbt einen schmerzhaften Tod.
Der Schläfer wird vor ekelhaften Fliegen geschützt - er wird von Blutegeln angegriffen. Wasser und Land, sie leben hier überall - in jeder Pfütze, im Moos, unter Steinen, Laub, auf Büschen und Bäumen. Landegel kriechen überraschend schnell. Sie spüren die Beute und stürzen sich gierig auf vorbeikommende Menschen und Tiere, wobei sie sich um ihre Beine, ihren Hals und ihren Hinterkopf klammern. Sie kriechen in den Rachen und sogar in die Luftröhre zum Schlafenden. Nachdem er Blut gesaugt hat, schwillt der Blutegel an, verschließt die Luftröhre wie ein Korken und die Person erstickt.

Viele andere Schrecken erwarten den Menschen in der "grünen Hölle" der Tropen.
Ich habe nicht einmal ein Drittel der gefährlichen Tiere genannt, keine einzige tödliche Pflanze wurde erwähnt. Und ist das nicht genug!
Denken Sie auch an Raubtiere, giftige Kreaturen - Schlangen, Spinnen, Skorpione, Tausendfüßler, Tsetse-Fliegen, die ganze Regionen Afrikas verwüsten, südamerikanische Käfer - Überträger einer der Schlafkrankheit ähnlichen Krankheit, Vampire, Zecken ...
Hier verursacht sogar gewöhnlicher Regen oft ein schmerzhaftes Fieber bei einer Person. Arkady Fidler hat am eigenen Leib erfahren, dass es in den Wäldern Brasiliens gilt, Regen wie Feuer zu meiden. Es verursacht schnell "starke Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, Fieber und andere Beschwerden".
Stanley spricht über den schnellen Tod mehrerer seiner Träger durch einen kalten tropischen Regenguss.
Aber die schrecklichste Geißel der Tropen sind keine Raubfische und Ameisen, nicht giftige Reptilien, und unsichtbare Kreaturen: mikroskopisch kleine Bakterien und Bazillen, Erreger gefährlicher Krankheiten.

Es gibt Hunderte von ihnen, studiert, halb studiert und Fachleuten unbekannt. Malaria, Schlafkrankheit, ihre südamerikanische "Schwester" - Chagas-Krankheit, tropische Amöbenruhr, Gelbfieber, Himbeerpocken, Yaws, schwarze Pocken, Elephantiasis, Beriberi, schwarze Kalaazar-Krankheit, Ulcus Pendin, Dengue-Fieber, Bilharziose ...
Liest du alles!
Gegen viele von ihnen gibt es keine wirksamen Mittel. Die „heilbarste" Tropenkrankheit - Malaria verwüstet weite Teile der Erde, ganze Länder werden unbewohnt. In letzter Zeit erkranken allein in Indien jährlich etwa 100 Millionen Menschen an Malaria, mehr als eine Million sterben! In Teilen Afrikas tötet die Schlafkrankheit während einer Epidemie bis zu zwei Drittel der Bevölkerung. In den letzten Jahrzehnten sind mehr als eine Million Menschen daran gestorben.
Aus diesem Grund vermeiden Abenteurer - Reisende, Jäger, Sportler und sogar Sammler und Entdecker auf ihren Reisen in tropische Länder tödliche Wildnis, feuchte und düstere Wälder.
Ein seltener Entdecker wagte es, tief in die schreckliche Selva vorzudringen. Und wer wagte, er kam nicht immer zurück.
Nachdem sie mehrere Monate in irgendeinem „Toldo“ eines europäischen Siedlers oder in einem Indianerdorf am Flussufer verbracht und wissenschaftliches Material von den Häuten erschossener Tiere und Vögel und Insekten gesammelt haben, die im Licht gefangen wurden, verlassen Zoologen eilig die unwirtliche Region mit ihrer Konstante Gefahren und schwächenden Krankheiten, wo nichts zu machen ist, sich hinzulegen, sich nicht hinzusetzen, nicht im kühlen Schatten ein Nickerchen zu machen, nicht in der Hitze zu schwimmen, wo sogar der Regen Todesangst haben muss und wo es so ist man kann sich leicht verirren wie im ägyptischen Labyrinth. Nachdem Sie mehrere Kilometer tief in den Wald eingedrungen sind, riskieren Sie, nie wieder zurückzukommen. Für mehrere schmerzhafte Monate, die hier verbracht werden, wird der Wald - ein Tempel von sagenhafter Schönheit - zu einem "Tempel der Trauer", "Mutter der Nebel und Verzweiflung", "Frau des Schweigens". Schnell, raus hier!

Und die riesigen Bäume, deren Kraft und Strenge sogar die ersten Konquistadoren in Ehrfurcht versetzten, stehen wachsam Wache, gleichgültig gegenüber menschlichen Freuden und Ängsten, und bewachen die Ein- und Ausgänge zur Behausung noch unbekannter Geheimnisse. Dort, hinter der undurchdringlichen Mauer dieser stillen Wächter, ist die wilde Selva - das zitternde Herz der unberührten Natur.
"Neugeborene Arten"
"Glauben Sie nicht all den Fantasiegeschichten über den Dschungel, aber denken Sie daran, dass sich hier selbst die unglaublichsten Geschichten als wahr herausstellen können." Solche Ratschläge gibt K. Winton seinen Lesern in dem Buch „Whisper of the Jungle“. Er widmete dem Studium mehr als zwanzig Jahre Regenwald Südamerika. Er kehrte in sein Heimatland, die USA, zurück und hielt eine Vortragsreihe unter einem sehr unerwarteten Titel: „Hospitable Jungle“. Er argumentierte, dass die Gefahren dieser Orte von den Autoren der Abenteuerliteratur stark übertrieben würden.
In dem Buch „Whisper of the Jungle“ versucht K. Vinton, den Mythos der „unmenschlichen Selva“ zu entlarven. Aber seine Argumente klingen nicht ganz überzeugend: K. Winton offenbart die Empfindungen skrupelloser Schriftsteller und beschreibt nur einige der gefährlichen Tiere des Amazonas. Aber auch in seiner wohlwollenden Interpretation sehen die Heldentaten von Vampiren, Piray, Candiru und anderen Raubtieren ziemlich gruselig aus.

Candiru ist kein Mythos. Candiru existieren, sagt K. Winton, und fügen ihren Opfern wirklich viel Qual zu. Aber diese blutrünstigen "Dämonen" können manchmal mit einer Tasse bitterem Jagua-Fruchtsaft aus dem Körper einer Person vertrieben werden, "wobei einem schrecklich übel wird".
Winton und seine Gefährten mussten in einigen Nebenflüssen des Amazonas bis zum Hals ins Wasser gehen, und die Pirahas rasten vorbei, ohne auf sie zu achten. Aber die Reisenden trafen einen Indianer, dessen Zeigefinger von einer Pirayah abgebissen worden war, als er sich im Fluss die Hände wusch.
Ein Moskitonetz schützt perfekt vor blutsaugenden Fledermäusen, aber die Vampire haben es dennoch geschafft, über Nacht viel Blut von einem Reisenden in Panama zu trinken. Der Mann war so schwach, dass er sich am nächsten Morgen kaum noch schleppen konnte.
K. Vinton beschrieb perfekt das Leben vieler Bewohner des Tropenwaldes. Aber er konnte seine Hauptthese nicht beweisen - über die Gastfreundschaft des Dschungels. Für den Leser mag es interessant sein zu erfahren, wie das Buch von K. Winton erschienen ist. Es gab eine Sekunde Weltkrieg. Amerikanische Soldaten, die unter dem plausiblen Vorwand der "Verteidigung des amerikanischen Kontinents" in die Länder Mittel- und Südamerikas geschickt wurden, hatten Angst vor der Selva. Sie weigerten sich, in den Dschungel zu gehen. Die Armeeführung bat den Biologen C. Winton, eine Reihe von Vorträgen über die Unbegründetheit ihrer Befürchtungen zu lesen. Winton hat es geschafft. Aus den Vorträgen ist das Buch „Whisper of the Jungle“ entstanden. Sein Autor verfolgte ein ganz bestimmtes Ziel – den Tropenwald von seiner guten Seite zu zeigen.

Unser Buch hat einen anderen Zweck. Die Leser werden weiter sehen, dass einige der darin erzählten Geschichten einer Klärung bedürfen. Warum ist zum Beispiel noch nicht sicher geklärt, ob der afrikanische „Bär“ oder „Beuteltier“ tatsächlich existiert? Warum wird der vor über vierzig Jahren in den Wäldern des Kongo entdeckte Wassermungo nicht gefangen?
Die Antwort auf diese Fragen ist die Unwirtlichkeit des Dschungels!
Der Hauptgrund für die schlechte Erforschung des Tropenwaldes ist die Unzugänglichkeit seiner inneren Regionen für umfangreiche Forschung. Die Arena der wissenschaftlichen Forschung ist hier so groß und die Natur so vielfältig, dass kurzfristige Expeditionen einzelner Enthusiasten, die von Zeit zu Zeit hierher kommen, um zoologische Sammlungen zu sammeln, nicht ausreichen, um ihre innersten Geheimnisse zu befriedigen. Wir brauchen die gemeinsamen und freundschaftlichen Bemühungen von Hunderten von Spezialisten aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Berufen, wie in der Antarktis!
Nur eine solche Organisation wissenschaftliche Arbeiten liefert schnelle Ergebnisse und hilft, die spannenden Geheimnisse des „grünen Kontinents“ zu lüften. BEI Tropenwälder es lauern zweifellos noch viele weitere unbekannte Kreaturen.
Schließlich entdecken Zoologen jedes Jahr vor allem in den Tropen immer mehr neue Tiere. Experten beschreiben jedes Jahr durchschnittlich etwa zehntausend neue Arten, Unterarten und Varietäten. Im Grunde sind das natürlich Kleintiere - Insekten (die Hälfte aller neuesten zoologischen Entdeckungen), Mollusken, Würmer, kleine tropische Fische, Singvögel, Nagetiere, die Fledermäuse.
Es stimmt, einige Forscher ziehen, um es milde auszudrücken, voreilige Schlüsse und nehmen eine der Wissenschaft bereits bekannte Tierart als neue Art an, die nur geringfügige Unterschiede aufweist, so dass die Anzahl der tatsächlichen Entdeckungen viel geringer ist als die angegebene Zahl.
In den letzten 60 Jahren wurden in verschiedenen Ländern (hauptsächlich in tropischen Wäldern) große Tiere gefunden - 34 bisher unbekannte Arten und Unterarten von Tieren und Vögeln. Zwölf von ihnen gehören nicht nur zu neuen Arten, sondern auch zu neuen Gattungen, und ein seltsamer Vogel sogar zu einer neuen Familie; Diese Tiere sind daher mit sehr eigentümlichen Merkmalen und ziemlich scharfen Unterschieden zu den bereits vorhandenen ausgestattet der Wissenschaft bekannt Typen.
Zur besseren Überzeugungskraft werde ich diese 34 neu entdeckten Tierarten auflisten.
Affe
1. Berggorilla. 1903 in den Bergwäldern Zentralafrikas entdeckt. Der größte der Affen.
2. Zwerggorilla. 1913 vom amerikanischen Zoologen Elliot beschrieben. Es lebt in den Wäldern des rechten Ufers des Unterlaufs des Kongo.
3. Zwergschimpanse. 1929 vom Zoologen Schwartz beschrieben. 1957 identifizierten die deutschen Zoologen Tratz und Geck ihn als eine besondere Gattung von Menschenaffen. Lebt in den Wäldern des Kongo.
4. Somalischer Pavian. 1942 in Somalia eröffnet.
5. Weißbeiniger Kolob oder Seidenaffe von Fernando Po (einer Insel im Golf von Guinea vor der Küste Kameruns). 1942 beschrieben.
6. Afrikanischer Wald- oder Rundohrelefant. 1900 vom deutschen Zoologen Machi in den Wäldern Kameruns entdeckt.
7. Zwergelefant. 1906 vom deutschen Professor Noack beschrieben (derzeit als Unterart des Waldelefanten angesehen).
8. Sumpfelefant. Hergestellt in den Wäldern des Kongo in der Nähe des Sees Leopold II. 1914 vom belgischen Zoologen Professor Schuteden (eine Unterart des Waldelefanten) beschrieben.
Nashörner
9. Sudanesisches Breitmaulnashorn oder Baumwollnashorn. 1901 vom englischen Reisenden Gibbons in den Sümpfen entdeckt Südsudan. Später in den Wäldern von Uele (nordöstlich des Kongo) entdeckt, gilt es als Unterart des südafrikanischen Breitmaulnashorns.
Andere Huftiere
10 Okapi "Waldgiraffe". Ein ungewöhnliches Tier, ähnlich den primitiven Giraffen, die einst in ganz Afrika und sogar in Westeuropa lebten. 1900 in den Wäldern von Ituri und anderen Gebieten im Osten des Kongo entdeckt.
11. Riesenwaldschwein - der größte Vertreter von Wildschweinen, kombiniert die Merkmale europäischer Wildschweine und afrikanischer Warzenschweine. 1904 in den Bergwäldern Kenias entdeckt.
12. Bergnyala, eine Antilope mit spiralförmigen Hörnern. - 1910 in den Bergen Äthiopiens entdeckt. Sein nächster Verwandter, der mosambikanische Nyala, lebt in Südafrika.
13. Goldener Takin oder "Bergbüffel", ein seltsames Huftier, das in In letzter Zeit in der Nähe der Moschusochsen Grönlands. 1911 in Tibet eröffnet. Sein Verwandter, der graue Takin, wurde 60 Jahre zuvor, im Jahr 1850, beschrieben.
14. "Grauer Stier" oder Kou-Beute. 1937 vom französischen Zoologen Urbain in den Wäldern Kambodschas eröffnet, einer der größten Wildbullen.
15. Schwarzer Tapir von Sumatra. 1936 vom holländischen Zoologen Kuiper beschrieben. Eine Unterart des indischen Tapirs.
16. Argentinisches Vicuña, eine viel größere Unterart des gemeinen Vicuña. 1944 vom deutschen Zoologen Krumbigel beschrieben.
17. Fischfressende Ginsterkatze oder „Wassermungo“. Von Jägern im Ituri-Regenwald (Nordosten des Kongo) entdeckt. 1919 vom amerikanischen Zoologen Allen beschrieben.
18. Königlicher oder gestreifter Gepard. Hergestellt 1927 in Südrhodesien vom Jäger Cooper, beschrieben vom englischen Zoologen Pocock. Der größte Vertreter der Geparden.
19. Hagenbecks Bergwolf. 1949 vom deutschen Zoologen Krumbigel anhand von Haut und Schädel beschrieben. Lebt laut Anwohnern in der Kordillere.
aquatische Säugetiere
20. Weißer Delphin. 1918 vom amerikanischen Zoologen Miller im Dongting-See in China entdeckt.
21. Tasmcetus oder neuseeländischer Wal (eine neue Art und Gattung aus der Familie der Schnabelwale). 1937 beschrieben.
22. Eine neue Seelöwenart. 1953 vom norwegischen Zoologen Sivertsen auf den Galapagosinseln entdeckt.
23. Kurzgesichtiger Delfin Ogneva. 1955 vom sowjetischen Zoologen M. Sleptsov im nordwestlichen Teil des Pazifischen Ozeans entdeckt. Einige Experten halten diese Art für nicht existent.
24. Eine neue Art von Gürtelzahnwalen. 1957 vor der Küste Japans hergestellt, 1958 von dem japanischen Zoologen Dr. Nishivaki beschrieben.
25. Eine neue Art von Krähe. Es wurde 1934 vom deutschen Ornithologen Stresemann in den Wäldern von Queensland (einem Bundesstaat im Nordosten Australiens) entdeckt.
26. Afrikanischer Pfau. Es wurde 1936 vom amerikanischen Ornithologen Chapin entdeckt, zuerst im Schrank des Museums des Kongo (in Belgien), dann in den Wäldern von Ituri und Sankuru (Ost-Kongo).
27. Stresemanns Zavatariornis, ein seltsamer Vogel, dessen Klassifizierung die Schaffung einer neuen Familie erforderte. 1938 vom Italiener Moltoni in Südabessinien entdeckt.
28. Gehörnter Gokko. 1939 in den Tropenwäldern Boliviens entdeckt.
29. Mayers Paradiesvogel. 1939 vom englischen Zoologen Stonor beschrieben.
30. Neue Eule. 1939 vom deutschen Zoologen Neumann auf der Insel Celebes entdeckt.
31. Laube der besonderen Art. 1940 in den Wäldern von Neuguinea entdeckt.
32. Neuer Trogon, ein Vogel, der einem Ziegenmelker ähnelt, aber größer und schöner ist. 1948 in Kolumbien eröffnet.
33. Sturmvogel, genannt "der Letzte". 1949 im Pazifik vom amerikanischen Ornithologen Murphy entdeckt.
Reptilien
34. Riesenwaran. 1912 auf der Insel Komodo (Indonesien) eröffnet.
Es ist bezeichnend, dass 13 der aufgeführten Tiere vor 1925 entdeckt wurden und 21 - von 1925 bis 1955. Das deutet darauf hin, dass die natürlichen „Verstecke“, die unbekannte Tiere verstecken, noch nicht knapp geworden sind.
Hier ist zum Beispiel eine "nicht abnehmende Progression" ornithologischer Funde über mehrere Nachkriegsjahre. Drei neue Vogelarten wurden 1945 entdeckt, sieben 1946, drei 1947, zwei 1948, vier 1949, fünf 1950 und fünf 1951.
Der größte Spezialist für Tiertaxonomie, der amerikanische Zoologe Ernst Mayer, glaubt, dass mehr als 100 der Wissenschaft völlig unbekannte Vogelarten auf der Erde leben. Die Zahl der unentdeckten Insekten ist ungleich größer – etwa zwei Millionen!
Entomologen haben offenbar noch viel zu tun.
In jeder Gruppe nicht sehr großer Tiere - Würmer, Schwämme, Krebstiere, Weichtiere - sind jedoch derzeit nur etwa 60-50 und sogar 40% aller auf der Erde vorkommenden Arten offen.
Es wird angenommen, dass die Anzahl unentdeckter Amphibien, Reptilien und Säugetiere viel geringer ist - nur etwa 10% der bekannten Artenzahl dieser Tiere. Aber 10% sind auch viel! Damit können wir in Zukunft mit der Entdeckung von weiteren 600 neuen Amphibien und Reptilien sowie 300 Säugetieren rechnen. Die überwiegende Mehrheit werden natürlich Frösche, Molche, Eidechsen, kleine Nagetiere, Fledermäuse und insektenfressende Tiere sein.
Gibt es Hoffnung, noch unbekannte Raubtiere wie Löwen und Leoparden auf der Erde zu entdecken? Oder neue Menschenaffen, Antilopen, Elefanten, Wale und andere Großtiere?
Antworten auf diese Fragen suchen wir in den folgenden Kapiteln des Buches.

"Cousins" aus dem Dschungel
Pongo der Elefantenjäger
Vor 2400 Jahren brachte der karthagische Seefahrer Gannon seltsame Neuigkeiten von einer Reise an die Küsten Westafrikas. Er berichtete von wilden, haarigen Männern und Frauen, die der Übersetzer "Gorillas" nannte. Reisende trafen sie auf den Höhen von Sierra Leone. Wilde "Männer" begannen, Steine auf die Karthager zu werfen. Die Soldaten erwischten mehrere haarige „Frauen“.
Es wird angenommen, dass die Tiere, die Gannon sah, überhaupt keine Gorillas waren, sondern Paviane. Doch seitdem ist das Wort „Gorilla“ nicht mehr über die Lippen der Europäer gegangen.
Es vergingen jedoch Jahrhunderte, aber niemand traf die „haarigen Waldmenschen“ in Afrika, niemand hörte etwas von ihnen. Und selbst mittelalterliche Geographen, die leicht an Menschen mit „Hundeköpfen“ und kopflosen Lemnien mit Augen auf der Brust glaubten, begannen an der wahren Existenz von Gorillas zu zweifeln. Nach und nach etablierte sich unter Naturforschern die Meinung, dass die legendären Gorillas nur Schimpansen seien, "übertrieben" durch Gerüchte. Und Schimpansen waren zu dieser Zeit in Europa bereits bekannt. (1641 wurde der erste lebende Schimpanse nach Holland gebracht. Er wurde vom Anatom Tulp ausführlich beschrieben.)
Ende des 16. Jahrhunderts wurde der englische Seefahrer Andrei Betel von den Portugiesen gefangen genommen. Achtzehn Jahre lang lebte er in Afrika, nicht weit von Angola. Betel beschrieb sein Leben im wilden Land in dem Aufsatz "Die erstaunlichen Abenteuer von Andrei Betel", der 1625 in einer Reisesammlung veröffentlicht wurde. Betel spricht über zwei riesige Affen - Engeko und Pongo. Engeko ist ein Schimpanse, aber Pongo ist definitiv ein Gorilla. Pongo sieht aus wie ein Mensch, aber er kann nicht einmal einen Scheit ins Feuer werfen. Dieses Monster ist ein echter Riese. Mit einer Keule bewaffnet tötet er Menschen und jagt ... Elefanten. Es ist unmöglich, einen lebenden Pongo zu fangen, und einen toten zu finden, ist auch nicht einfach, weil Pongos ihre Toten unter Laub begraben.
Bethels unglaubliche Geschichten überzeugten nur wenige Menschen. Nur wenige Naturforscher glaubten damals an die Existenz von Gorillas. Unter den „Gläubigen“ war der berühmte französische Wissenschaftler Buffon. Er gab zu, dass Bethels Geschichten eine echte Grundlage haben könnten. Aber die "Ungläubigen" hielten die haarigen, affenähnlichen Menschen für eine unmögliche Chimäre, wie diese lächerlichen Monster, die die Giebel der Kathedrale Notre Dame schmücken.
Aber 1847 veröffentlichte Dr. Thomas Savage, der ein Jahr lang am Fluss Gabon (der südlich von Kamerun in den Golf von Guinea mündet) lebte, seine wissenschaftlichen Arbeiten in Boston. Dies war die erste zuverlässige Beschreibung der Lebensweise und des Aussehens von Gorillas.
„Ein Gorilla“, schrieb Savage, „eineinhalb Meter groß. Ihr Körper ist mit dichtem schwarzem Haar bedeckt. Im Alter wird der Gorilla grau.
Diese Affen leben in Herden, und in jeder Herde gibt es mehr Weibchen als Männchen. Geschichten darüber, wie Gorillas Frauen entführen und dass sie gelegentlich Elefanten in die Flucht schlagen können, sind völlig absurd und haltlos. Dieselben Taten werden manchmal Schimpansen zugeschrieben, und das ist noch lächerlicher.
Gorillas, wie Schimpansen, errichten ihre Behausungen – wenn sie Behausungen genannt werden können – in Bäumen. Diese Behausungen bestehen aus Ästen, die zwischen dichtem Blattwerk an den Astgabeln befestigt sind. Affen befinden sich nur nachts in ihnen. Anders als Schimpansen laufen Gorillas niemals vor Menschen davon. Sie sind wild und gehen leicht zum Angriff über. Die Einheimischen vermeiden es, sie zu konfrontieren und kämpfen nur zur Selbstverteidigung.
Wenn sie angegriffen werden, stoßen die Männchen ein schreckliches Gebrüll aus, das sich weit durch das umliegende Dickicht ausbreitet. Beim Atmen öffnet der Gorilla sein Maul weit. Ihre Unterlippe hängt bis zum Kinn herunter. Behaarte Hautfalten verlaufen bis zu den Augenbrauen. All dies verleiht dem Gorilla einen Ausdruck außergewöhnlicher Wildheit. Junge Gorillas und Weibchen verschwinden, sobald sie den alarmierenden Schrei ihres Anführers hören. Und er stößt schreckliche Schreie aus und stürzt sich wütend auf den Feind. Ist sich der Jäger der Treffsicherheit des Schusses nicht ganz sicher, lässt er den Gorilla schließen und hindert ihn nicht daran, die Mündung des Gewehrs mit den Händen zu packen und ins Maul zu stecken, was diese Tiere normalerweise tun, und nur dann zieht den Abzug. Ein Fehlschuss kostet den Jäger ausnahmslos das Leben.
Das Überraschendste ist, dass diese sehr realitätsnahe Beschreibung der Gorillas von Savage nur aus den Worten der Anwohner zusammengestellt wurde. Er selbst sah zufällig keinen einzigen lebenden Gorilla.
Dr. Savage brachte zwar mehrere Gorillaschädel aus Afrika mit. Aus diesen Schädeln beschrieb er zusammen mit Professor Wilman 1847 den Gorilla als eine neue Affenart und nannte ihn den „Höhlenbewohner-Gorilla“ (Troglodytes gorilla). "Schwarzer Höhlenbewohner" (Troglodytes niger) wurde damals ein Schimpanse genannt. Aber vier Jahre später, im Jahr 1851, bewies der französische Wissenschaftler Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, dass sich der Gorilla viel mehr vom Schimpansen unterschied, als Savage und Wilman dachten. Er stellte den Gorilla in eine eigene zoologische Gattung und gab ihm den Namen Gorilla gorilla.
So wurde das struppige Waldungeheuer nach jahrhundertelangen Zweifeln und Streitigkeiten endlich von der Wissenschaft anerkannt.
Doch keiner der Zoologen hat noch lebende Gorillas gesehen. Und daher könnten sich Skeptiker mit einem gewissen Recht mit dem Gedanken trösten, dass vielleicht ein Fehler unterlaufen ist: Wo ist die Garantie, dass nicht alle untersuchten Schädel zu einem bereits ausgestorbenen Tier gehören?
Acht Jahre nach Savages Bericht konnte jedoch selbst der hartgesottenste Thomas-Ungläubige keine solche Aussage machen.
Erster Europäer, der einen Gorilla tötete
1855 sah der berühmte Reisende und Zoologe Paul du Chaillu endlich den mysteriösen Gorilla.
So beschreibt er dieses bedeutsame Ereignis.
„Unweit des Lagers sahen wir ein verlassenes Dorf. An den Stellen, wo früher die Hütten standen, wuchs etwas, das wie Zuckerrohr aussah. Ich begann gierig, die Stängel dieser Pflanze zu brechen und den Saft auszusaugen. Plötzlich fiel meinen Begleitern ein Detail auf, das uns alle sehr begeisterte. Um uns herum lagen entwurzelte Zuckerrohrhalme auf dem Boden. Jemand zog sie heraus und warf sie dann auf den Boden. Wie wir hat er ihnen den Saft ausgesaugt. Dies waren zweifellos die Fußabdrücke eines kürzlich besuchten Gorillas. Das Herz war voller Freude. Meine schwarzen Begleiter sahen sich schweigend an. Da war ein Flüstern: „Ngila“ (Gorilla).
Wir folgten der Spur, suchten auf dem Boden nach zerkauten Rohrstücken und stießen schließlich auf die Fußspuren des so leidenschaftlich gesuchten Tieres. Es war das erste Mal, dass ich den Fußabdruck eines solchen Fußes gesehen habe, und es fällt mir schwer zu sagen, was ich in diesen Momenten erlebt habe. So konnte ich jede Sekunde einem Monster gegenüberstehen, über dessen Stärke, Wildheit und List mir die Einheimischen so viel erzählten.
Dieses Tier ist den Leuten der Wissenschaft fast unbekannt. Kein Weißer hat ihn je gejagt. Mein Herz schlug so laut, dass ich befürchtete, sein Klopfen würde den Gorilla erreichen. Die Nerven spannten sich schmerzhaft an.
Anhand der Spuren stellten wir fest, dass hier vier oder fünf offenbar nicht sehr große Gorillas gewesen waren. Mal bewegten sie sich auf allen Vieren, mal setzten sie sich auf den Boden, um das mitgeführte Zuckerrohr zu kauen. Die Verfolgung wurde intensiver. Ich muss gestehen, dass ich noch nie in meinem Leben so besorgt war wie in diesem Moment.
Nachdem wir vom Hügel heruntergekommen waren, überquerten wir den Fluss entlang des Stammes eines umgestürzten Baumes und näherten uns mehreren Granitfelsen. Am Fuß der Klippe lag der halb verrottete Stamm eines riesigen Baumes. Nach einer Reihe von Anzeichen zu urteilen, haben kürzlich Gorillas auf diesem Stamm gesessen. Wir machten uns mit äußerster Vorsicht auf den Weg nach vorne. Plötzlich hörte ich einen seltsamen, halbmenschlichen Schrei, und danach stürmten vier junge Gorillas an uns vorbei in den Wald. Schüsse fielen. Wir jagten ihnen nach, aber sie kannten den Wald besser als wir. Wir liefen bis zum völligen Kraftverlust ohne Ergebnis: Geschickte Tiere bewegten sich schneller als wir. Wir stapften langsam zum Lager, wo verängstigte Frauen auf uns warteten.
Später hatte du Chail mehr Glück und erschoss mehrere Gorillas. Vielleicht stammt eine der dramatischsten Beschreibungen des Angriffs eines wütenden Gorillas aus seiner Feder.
„Plötzlich teilten sich die Büsche – und vor uns war ein riesiger männlicher Gorilla. Er ging auf allen Vieren durch das Dickicht, aber als er Menschen sah, richtete er sich zu seiner vollen Größe auf und begann uns herausfordernd anzusehen. Diesen Anblick werde ich nie vergessen. Er war ungefähr zwei Meter groß, sein Körper war riesig, seine Brust war kräftig, seine Arme waren groß und muskulös. Seine wild lodernden Augen verliehen seinem Gesichtsausdruck einen dämonischen Ausdruck, etwas, das man nur in einem Albtraum sehen konnte; So stand dieser Herr der afrikanischen Wälder vor uns. Er zeigte keine Angst. Er schlug sich mit mächtigen Fäusten auf die Brust und drückte damit seine Bereitschaft aus, sich dem Kampf anzuschließen. Seine Brust summte wie eine Trommel, und gleichzeitig brüllte er, Flammen strahlten buchstäblich aus seinen Augen, aber wir zogen uns nicht zurück und bereiteten uns auf die Verteidigung vor.

Auf dem Kopf des Affen erhob sich ein haariger Kamm; der Kamm blühte jetzt auf, dann sträubte er sich wieder; Als der Gorilla sein Maul zum Bellen öffnete, waren riesige Zähne sichtbar. Der Gorilla machte ein paar Schritte nach vorne, hielt inne, stieß erneut ein bedrohliches Gebrüll aus, rückte weiter vor und erstarrte schließlich sechs Meter von uns entfernt. Als sie erneut knurrte und sich vor Wut auf die Brust schlug, schossen wir. Der Gorilla fiel zu Boden und stieß ein Stöhnen aus, das sowohl menschlich als auch tierisch war."
Jetzt zweifelte niemand daran, dass in Afrika seltsame vierarmige Monster leben. Das Verbreitungsgebiet fällt mit der Zone des tropischen Regenwaldes zusammen. Ende des letzten Jahrhunderts wurde festgestellt, dass Gorillas im Westen des tropischen Afrikas leben, in Ländern an der Küste des Golfs von Guinea von Ostnigeria bis Kamerun und Gabun. Daher wurden diese Gorillas als Küstengorillas bezeichnet. Ganz im Westen des Kongo lebt eine eng verwandte Art, der sogenannte Rotkopfgorilla.
Alter Mann aus Kivu
1863 erhielt die London Geographical Society ein seltsames Telegramm: "Neal geht es gut." Das Telegramm überraschte nicht nur Telegraphen, es begeisterte die gesamte Wissenschaftswelt Großbritanniens. Mitglieder der London Geographical Society verstanden sofort, worum es in dem Telegramm ging. Vor drei Jahren gingen die englischen Reisenden John Speke und Augustus Grant auf der Suche nach der Quelle des Nils tief nach Afrika.
Und jetzt kommt ein Telegramm von Speke; "Neal geht es gut." Damit ist das uralte Rätsel gelöst. Speke und Grant dringen in das Märchenland der "Mondberge" ein, in denen Gerüchten zufolge der Weiße Nil geboren wird, und entdecken seinen Ursprung.
Im selben Jahr, 1863, erzählte Speke seine Abenteuer in einem zweibändigen Buch, The Discovery of the Sources of the Nile. Ein Jahr später starb er bei einem Jagdunfall in England.
Dem mutigen Forscher gelang es in seinem kurzen Leben (er starb im Alter von 37 Jahren) viele wichtige geografische Entdeckungen zu machen. Von seinen Reisen brachte er für Zoologen interessante Informationen mit. Aber zunächst wurde ihnen nicht die gebührende Bedeutung beigemessen. Schließlich berichtete Speke weder mehr noch weniger, sondern von einem schrecklichen Zottelmonster, das in den Bergwäldern Ruandas lebt. Dieses Monster „umarmt Frauen so fest, dass sie sterben“. Die Neger nannten ihn „ngila“ und sagten, dass das Tier in seinem Aussehen wie ein Mensch aussah, aber er hatte einen solchen Lange Hände dass es einen Elefanten über den Bauch fassen kann. Wer könnte es glauben? Außerdem lebten weit im Westen Gorillas – die einzigen Kreaturen, die als fantastische „ngila“ klassifiziert werden konnten.
Es war bekannt, dass ihr Verbreitungsgebiet nach Osten nicht über die westlichsten Regionen des Kongo hinausreichte. Daher wurde Spekes Botschaft von Zoologen ignoriert. Und vergebens!
1901 betrachtete der deutsche Säugetierspezialist Machi mit Erstaunen die gigantische Affenhaut, die Kapitän Beringe vom Ufer des Kivu-Sees (nördlich von Tanganjika) mitbrachte. Es war ein Ngila, ein Berggorilla. Machi beschrieb es 1903 und benannte es zu Ehren von Captain Bering - Gorilla beringei.
Der Berggorilla ist noch mächtiger als seine Cousins aus den Wäldern des Golfs von Guinea, die Küstengorillas. Das Wachstum großer Männchen erreicht zwei Meter (und in Ausnahmefällen sogar 2 Meter 30 Zentimeter) und das Gewicht beträgt 200-350 Kilogramm. Der Brustumfang eines alten männlichen Berggorillas beträgt 1 Meter 70 Zentimeter, der Umfang des Bizeps beträgt 65 Zentimeter und die Armspannweite erreicht 2,7 Meter!
Das reicht fast aus, um einen kleinen Elefanten quer über den Oberkörper zu packen.
Touristen, Jäger, Tierjäger, die nach dem Ersten Weltkrieg Zentralafrika überschwemmten, träumten davon, nicht nur Antilopenhörner, sondern auch die Kopfhaut des „alten Mannes aus Kivu“ zu bekommen. „Der Berggorilla“, schrieb die „große Vogelscheuche“ Ackley, „ist zusammen mit Elefanten und Löwen zu einem „modischen Wild“ geworden. Das Schlagen der Gorillas muss sofort aufhören.“

Nur wenige Menschen haben das Leben dieser Affen in freier Wildbahn studiert. Selbst tote Gorillas fallen selten in die Hände von Wissenschaftlern. Inzwischen nimmt die Zahl der Gorillas rapide ab. Im März 1922 wurde schließlich das Berggorilla-Reservat eingerichtet. Mehrere tausend dieser vierarmigen Riesen leben heute in den Wäldern an den Hängen der Berge von Mykeno, Carisimba und Visoke (Kivu-Region).
Zwerggorilla
Es stellt sich heraus, dass es Zwerggorillas gibt. Aber über sie ist fast nichts bekannt.
Die Häute von Zwerggorillas landen gelegentlich aus den Sammlungen von Jägern in Museen, aber keiner der Zoologen hat die Tiere jemals selbst gesehen. Zwerggorillas wurden im "Dschungel" ... der Naturkundemuseen entdeckt. Der weltgrößte Affenspezialist, der amerikanische Zoologe Daniel Elliot, hat die Museumssammlungen von Menschenaffen studiert. Unter ihnen fand er mehrere seltsame Skelette und Häute. Ohne Zweifel gehörten sie zu erwachsenen Gorillas, aber von sehr kleiner Statur: Die Länge des männlichen Zwergs vom Scheitel bis zu den Fersen beträgt 1 Meter 40 Zentimeter (die durchschnittliche Größe eines Schimpansen). Die Fellfarbe ist dunkelgrau mit einem rötlich-braunen Farbton an Kopf und Schultern.
Laut den Etiketten auf diesen interessanten Funden wurde festgestellt, dass Zwerggorillas in Wäldern entlang der Ufer der Mündung des Flusses Ogooue (Gabun) leben. Mehr ist über sie nicht bekannt.
1913 sprach Elliot in einer dreibändigen Beschreibung von Affen über seine Entdeckung. Er nannte den Zwerggorilla Pseudogorilla mayema. Sein anderer wissenschaftlicher Name ist Gorilla (Pseudogorilla) ellioti.
16 Jahre nach der Entdeckung von Elliot untersuchte der Deutsche Ernst Schwartz auch die im Museum des Kongo (in Belgien) gesammelten Affensammlungen. Unter den Exponaten, die laut Museumskatalogen zu verschiedenen Arten von Schimpansen gehörten, fand er viele sehr zerbrechliche und kleine Knochen.
Schwartz dachte, er hätte es mit einem Zwergschimpansen zu tun und nannte ihn 1929 Pan satyrus paniscus.
Später wurden mehrere dieser Affen lebendig nach Europa und Amerika gebracht, und andere Wissenschaftler lernten sie kennen. Die Struktur von Schädel, Skelett, Muskulatur und Fell des Zwergschimpansen wurde 1933 von Coolidge, 1941 von Rode und 1952 von Miller untersucht. Freshkop (1935), Huck (1939) und Urbain (1940) schrieben über sein Verhalten und seinen Lebensstil. Einige Wissenschaftler (Coolidge, Huck, Miller, Freshkop) schlugen vor, den Zwergschimpansen in eine eigene Art zu trennen. Andere dachten, es sei nur eine Unterart des gewöhnlichen Schimpansen.
Aber es stellte sich heraus, dass weder das eine noch das andere recht hatte. Ein trauriger Vorfall in einem deutschen Zoo veranlasste zwei Zoologen, Zwergschimpansen genauer unter die Lupe zu nehmen. Als Ergebnis kamen sie zu dem Schluss, dass diese unterdimensionierten Schimpansen überhaupt keine Schimpansen sind, sondern eine ganz besondere und für die Wissenschaft neue Gattung der Menschenaffen, so eigenständig wie beispielsweise die Gattung der Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und Gibbons.
Es lohnt sich, ausführlicher über diese Entdeckung zu sprechen.
Bonobo ist unser neuer Verwandter
In der deutschen Stadt Hellabrunner, unweit von München, starben während der Angriffe amerikanischer Flugzeuge im Jahr 1944 viele Menschenaffen im Zoo. Die armen Tiere starben nicht an Wunden und Quetschungen, sondern an ... Angst. Das höllische Grollen der Artillerie, explodierende Bomben und Erdrutsche versetzten sie in unbeschreibliches Entsetzen. In Panik stürmten sie um die Käfige herum und kündigten den menschenleeren Park mit herzzerreißenden Schreien an.
Zoowissenschaftler, die am nächsten Morgen ihre Verluste zählten, stellten fest, dass sich alle toten Affen durch einen zerbrechlichen Körperbau auszeichnen und, wie sie damals glaubten, zu einer Zwergschimpansenart gehören. Im Leben waren sie scheue Wesen, sie mieden die großen Affen.
Wissenschaftler waren erstaunt, dass nur Zwergschimpansen an dem nervösen Schock starben, den sie während des Bombenangriffs erlebten. Warum nahmen ihre größeren Brüder die gleichen Ereignisse ziemlich gelassen hin? Schließlich starb kein einziger großer Schimpanse während des Bombenangriffs.
Offenbar ist dies kein Zufall. Wissenschaftler begannen, die Affen, die bisher fälschlicherweise als Zwergschimpansen galten, genauer unter die Lupe zu nehmen. Achten Sie auf die Schreie dieser Affen. Der Tierpfleger versicherte den Wissenschaftlern, dass sich kleine und große Schimpansen nicht verstehen, sie „sprechen“ seiner Meinung nach verschiedene Sprachen.
Kleine Schimpansen sind sehr mobil, freundlich und gesellig. Sie "chatten" ständig miteinander. In ihren Schreien sind die Vokale „a“ und „e“ zu hören. Affen begleiten ihre „Rede“ mit lebhaften Gesten.
Große Schimpansen sind düster und ungesellig. Ihre Stimme ist taub, und in ihren Schreien sind andere Vokale zu hören: „o“ und „u“. Manchmal, besonders wenn sie wütend sind, kreischen große Schimpansen. Sie stürzen sich aufeinander, beißen, kratzen. Kampfaffen versuchen mit ihren starken Armen, den Feind näher heranzuziehen und ihn mit ihren Zähnen zu packen.
Kleine Schimpansen werden selten wütend, streiten und kämpfen selten miteinander. Und im Kampf beißen sie nie, sondern belohnen sich nur mit Handschellen, „Box“. Affen haben schwache Fäuste, also schlagen sie lieber mit den Fersen zu.
Und vor einigen Jahren, im Jahr 1954, veröffentlichten die deutschen Wissenschaftler Eduard Tratz und Heinz Geck eine interessante Arbeit. Aufgrund ihrer Beobachtungen und Studien anderer Zoologen und Anatomen kamen sie zu dem Schluss, dass es sich bei den beim Hellarunner-Bombardement umgekommenen Affen nicht um eine Zwergschimpansenart, sondern um eine ganz besondere Art und Gattung von Menschenaffen (Bonobo paniscus) handelt. , sie unterscheiden sich so stark von allen anderen Affen und ihrer Psyche, ihrem Verhalten und ihrer Anatomie. Wissenschaftler haben der neuen Gattung den Namen „Bonobo“ gegeben – wie die Einheimischen diese Affen in ihrer Heimat im Kongo nennen. Kongolesen unterscheiden Bonobos von Schimpansen und anderen lokalen Vertretern der Affenrasse.
Die Familie unserer nächsten Verwandten im Tierreich – der Menschenaffen – ist also um ein weiteres neues Mitglied aufgestockt worden. Bisher gab es drei echte Menschenaffen – den Gorilla, den Schimpansen und den Orang-Utan. Jetzt sind es vier davon.
Die Leute fragen oft: Welcher der Affen ist dem Menschen am nächsten? Es ist schwierig, auf diese Frage eine eindeutige Antwort zu geben. Nach einigen Zeichen - ein Schimpanse, nach anderen - ein Gorilla, nach anderen - sogar ein Orang-Utan. Aber das Erstaunliche ist, dass die neu entdeckten Bonobos in vielerlei Hinsicht, insbesondere in der Schädelstruktur, dem Menschen näher zu sein scheinen als alle anderen Affen!
Die Bonobos haben einen abgerundeten, geräumigen Schädel, ohne die hochentwickelten Augenbrauenkämme und Kämme, die den Kopf eines Gorillas und Schimpansen entstellen. Bei allen anderen Affen ragt die Schnauze stark nach vorne, während die Stirn leicht konvex ist und nach hinten steil abfällt, als wäre sie von vorne nach hinten geschnitten. Bei Bonobos ist die Stirn stärker entwickelt, ihre Wölbungen beginnen unmittelbar hinter den Augenbrauenbögen und die Schnauze ragt leicht nach vorne. Der Hinterkopf des Bonobos ist ebenfalls abgerundet und leicht konvex.
Auch bei Bonobos sind Zoologen solche „menschlichen“ Merkmale aufgefallen: kleine Ohren, schmale Schultern, schlanker Körper und nicht breitbeinig, sondern schmal gepflegter Fuß. Bei Bonobos, dem vielleicht einzigen Vertreter im Tierreich, sind die Lippen nicht schwarz, sondern rötlich, fast wie beim Menschen.
Und noch ein tolles Feature. Menschenaffen bewegen sich auf gebeugten Beinen auf dem Boden, während sie sich auf ihre Hände stützen. Beim Gehen verlassen sich Bonobos ebenfalls auf ihre Hände, aber wie ein Mensch strecken sie ihre Beine an den Knien vollständig durch.
Wo leben unsere neuen Verwandten? Woher kommen sie? Bonobos leben, soweit heute bekannt, in den westlichen Regionen des Kongobeckens in dichten Urwäldern. Nur wenige große Tiere haben es geschafft, sich an das Leben in der düsteren und feuchten Wildnis im Inneren des Regenwaldes anzupassen. Daher haben Bonobos nur wenige gefährliche Feinde. Auch Schimpansenaffen sind Waldbewohner, halten sich aber dennoch lieber näher am Waldrand auf.

Zwei weitere neue Affen
1942 fing der deutsche Fallensteller Rue in Somalia einen Affen, dessen Namen er in keinem der Handbücher finden konnte. Der deutsche Zoologe Ludwig Zhukovsky erklärte Rue, dass das von ihm gefangene Tier der Wissenschaft noch unbekannt sei. Dies ist ein Pavian, aber von besonderer Art. L. Zhukovsky gab ihm den Namen Papio ruhei, was - Rue der Pavian ist.
Im selben Jahr untersuchte ein anderer deutscher Zoologe - Dr. Ingo Krumbigel - die Sammlungen von Säugetieren, die in den Wäldern der Insel Fernando Po (im Golf von Guinea, nicht weit von Kamerun) gesammelt wurden. Die Insel ist klein: Ihre Fläche beträgt 2100 Quadratkilometer. Aber es ist ziemlich dicht besiedelt: Mehr als 20.000 Menschen leben hier.
In den Wäldern der Insel leben eine Vielzahl von Tieren. Bereits 1838 stellte der englische Naturforscher Waterhouse eine detaillierte Liste aller vierbeinigen und gefiederten Bewohner von Fernando Po zusammen.
Aber weder Waterhouse noch andere Forscher, die nach ihm die Insel besuchten, bemerkten das vielleicht auffälligste Tier hier!
Krumbigel, der die Sammlungen von Fernando Po durchsuchte, entdeckte darin eine seltsame schwarz-weiße Haut eines unbekannten Affen; Waterhouse hat sie nie erwähnt. Und der Affe ist sehr auffällig bemalt - wie ein Meilenstein! Ihr Körper ist schwarz und ihre Arme, Beine und ihr Kamm auf ihrem Kopf sind weiß.
Kann es sein, fragt sich Krumbiegel, dass es die schwarz-weiße Affenart zu Waterhouses Zeiten noch gar nicht gab? Es entwickelte sich später, nach Waterhouses Reise nach Fernando Po, indem es sich von einigen einheimischen Affenarten „abknospte“, zum Beispiel von schwarzen Kolobs.
Dies ist jedoch unwahrscheinlich.
Krumbigel nannte den Affen, den er entdeckte, Colobus metternichi - Metternichs Colob.
Kolob oder Seidenaffen hat die Natur mit vielen einzigartigen Eigenschaften ausgestattet.
Sie ernähren sich ausschließlich von pflanzlicher Nahrung, hauptsächlich von Baumblättern. Ein riesiger Magen, wie der einer Kuh, ist in drei Abschnitte unterteilt. In den komplexen Labyrinthen des Magens werden holzige Blätter gemahlen und verdaut. Dieser nährstoffarme Kolob kann unglaublich viel fressen - 2,5 Kilogramm in einer Mahlzeit. Aber sie selbst wiegt normalerweise ungefähr 7 Kilogramm! Nachdem es satt gegessen hat, hängt das Tier an einem Ast und erstarrt in einem schläfrigen Schlummer, während es langsam sein Mittagessen verdaut. Bei Bedarf bewegen sich die Kolobs jedoch sehr schnell. Sie leben im obersten „Stockwerk“ des Regenwaldes. Um nach unten zu gehen, springen Kolobs von den Wipfeln riesiger Bäume direkt zu den unteren Ästen und fliegen eine Entfernung von mehreren zehn Metern.
Der Körper einiger Seidenaffen ist an den Seiten (von den Vorder- bis zu den Hinterbeinen) von einem dichten Saum aus langem weißem Haar umgeben. Am Ende des Schwanzes bildet das Haar einen prächtigen Fächer.
Fransen und Fächer sind keine Verzierungen, sondern wunderbare Anpassungen für den Gleitflug. Wenn ein Affe von der Spitze eines Baumes springt, schwellen lange Haare wie ein Fallschirm an und stützen ihn im Flug.
Kolobs sind die einzigen Affen, deren schöne Felle von Pelzhändlern gejagt werden.
Aber sie zu bekommen ist nicht einfach. Kolobs leben in Urwäldern auf den Wipfeln riesiger Bäume. Einige Arten von Seidenaffen sind der Wissenschaft nur von einigen Häuten bekannt, die Reisende von lokalen Jägern gekauft haben.
Seit wann werden Yetis gefangen?
Vor 62 Jahren, im Jahr 1899, beschrieb Weddell, einer der ersten Europäer, der Tibet betrat, in seinem Buch „In the Himalayas“ seltsame, menschenähnliche Fußspuren, denen er in den hohen Schneefeldern am Donkyala-Pass begegnete. Seitdem hat fast jede Expedition in den Himalaya Berichte über behaarte Affenmenschen gebracht, die hoch oben in den Bergen leben. Sherpas – nepalesische Hochländer – nennen diese fantastischen Tiere Yeti.
Zuerst wollte niemand glauben, dass humanoide Kreaturen im kargen Schnee des höchsten Dornenrückens der Welt leben könnten. Aber es scheint, dass sich immer überzeugendere Fakten ansammeln. Mehr als einmal sahen und fotografierten sie Fußabdrücke des Yetis, als hätten sie ihren Schrei gehört. Vielleicht sind das große aufrecht stehende Menschenaffen, so etwas wie "Schneegorillas"?
Menschen, die nicht an die Existenz von Bigfoot glauben, greifen in der Polemik mit seinen Anhängern normalerweise auf das folgende Argument zurück:
Wenn Bigfoot existiert, sagen sie, warum können sie ihn nicht immer noch fangen. Fangen, fangen - und kein Ergebnis.
Aber Tatsache ist, dass bis vor kurzem niemand versucht hat, den mysteriösen Yeti zu fangen, und das aus einem sehr einfachen Grund - niemand hat an ihn geglaubt!
Obwohl Zoologen vor mehr als 60 Jahren vom Yeti hörten, wurde die erste Expedition zu seiner Suche erst 1954 organisiert.
Im Frühjahr 1957 begann die amerikanische Expedition von Tom Slick in Nepal zu arbeiten. 1958 schloss sich eine schottische Expedition und 1959 eine weitere amerikanische Jagdgesellschaft an. Immer neue Expeditionen stürmen die Höhen des Himalaya und vielleicht wird der schwer fassbare Yeti gefangen. Natürlich, sofern vorhanden. Und genau das bezweifeln viele Zoologen sehr. Die Angelegenheit wurde durch die Tatsache verkompliziert, dass bestimmte Kreise in den Vereinigten Staaten sich beeilten, ein interessantes wissenschaftliches Problem für sehr unziemliche Zwecke auszunutzen. Wie einige indische Zeitungen berichteten, sind nicht alle amerikanischen Expeditionen im Himalaya an der Suche nach Bigfoot beteiligt. Dies ist nur ein von ihnen benutzter Vorwand, um in die Grenzregionen Nepals mit der Volksrepublik China einzudringen. Es ist in der Tat seltsam, dass es keine öffentlich zugänglichen Veröffentlichungen über die Arbeit einiger "wissenschaftlicher" Expeditionen gibt, die Nepal in den letzten Jahren besucht haben. Wo und wie sie ihre Arbeit verrichteten, ist im Dunkeln.
Der Leser wird sich erinnern, dass amerikanische „Entdecker“ vor einigen Jahren einen noch lächerlicheren Vorwand zur Grenzaufklärung benutzten: Sie suchten an den Hängen des Ararat nach der Arche Noah!
Das alles ist sehr unangenehm. Es ist jetzt nicht einfach, das Problem des Yeti - was ist wahr, was ist falsch - in einem Wirrwarr widersprüchlicher Mythen, Fakten und politischer Intrigen zu verstehen.
Gibt es Menschenaffen in Amerika?
Leser, die sich mit Zoologie ein wenig auskennen, werden sagen - warum diese Frage? Schließlich steht seit langem fest, dass es in Amerika keine Menschenaffen gibt und nie gab: In keinem der amerikanischen Länder wurden trotz sorgfältiger Suche fossile Überreste von Menschenaffen (also Menschenaffen) gefunden.
Dennoch behaupten einige Wissenschaftler, dass in Südamerika, in den Urwäldern des Amazonas und des Orinoco, Menschenaffen leben. Sie sagen sogar, dass ein solcher Affe einmal in die Hände von Forschern gefallen ist. So war es.
1917 tauchten der Schweizer Geologe Francis de Loy und eine Gruppe von Kameraden in die riesigen tropischen Wälder der Sierra Perilla-Bergkette (entlang der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela) ein.
Drei Jahre voller Abenteuer verbrachten Reisende in der Wildnis. Schließlich gingen sie erschöpft von den Strapazen an den Fluss Tarra (ein Nebenfluss des Catatumbo, der von Südwesten in den Golf von Maracaibo mündet). Hier, am Ufer des Flusses, begegneten sie seltsamen Tieren. Eines Tages hörten wir Lärm und Schreie. Aus den Zelten gesprungen; Zwei große, bösartige Affen näherten sich ihnen, winkten mit den Armen und stießen einen „Kriegsschrei“ aus. Sie gingen auf zwei Beinen, waren sehr wütend, brachen Äste und warfen sie auf Menschen, in der Hoffnung, die ungebetenen Außerirdischen aus ihrem Besitz zu vertreiben.
Die Reisenden wollten das aggressivste Männchen erschießen. Aber im entscheidenden Moment versteckte er sich hinter der Frau, und sie bekam alle Kugeln.
Der getötete Affe wurde auf eine Kiste gelegt, mit einem Stock am Kinn gestützt, um ihn in sitzender Position zu halten, und fotografiert.
De Lua behauptet, dass dieser erstaunliche Affe keinen Schwanz hatte. In ihrem Mund zählte er angeblich nicht 36, wie alle amerikanischen Affen, sondern nur 32 Zähne, wie Menschenaffen.
Der Affe wurde gemessen: Seine Länge betrug 1 Meter 57 Zentimeter.
Sie entfernten die Haut von ihr, sezierten den Schädel und den Unterkiefer. Aber leider! Im heißen Klima der Tropen verschlechterte sich die Haut schnell. Verloren irgendwo in der Wildnis des Waldes und im Kiefer eines Affen. Der Schädel blieb am längsten erhalten und wäre vielleicht nach Europa gebracht worden, wenn er nicht zum Koch der Expedition gekommen wäre. Der Koch war ein großartiges Original: Er entschied sich, den Schädel des einzigartigsten Affen als ... Salzstreuer zu verwenden. Zweifellos ist dies nicht der beste Weg, um zoologische Sammlungen zu erhalten. Unter dem Einfluss von Feuchtigkeit und Salz zerfiel der Schädel an den Nähten, und unglückliche Sammler entschieden sich, ihn wegzuwerfen.
Schlechte Beispiele sind ansteckend
Am schlimmsten fanden Montandon und de Lois Anhänger, die auf grobe Fälschungen zurückgriffen, um dem Mythos des amerikanischen Pithecanthropus neues Leben einzuhauchen.
1951 veröffentlichte Courteville, ein Schweizer Entdecker Südamerikas, ein Buch in Frankreich. Darin erzählt er von seinen Begegnungen mit riesigen schwanzlosen Affen in den Wäldern derselben Gegend, in der de Loy umherwanderte, und gibt sogar ein Foto von sich seltsame Kreatur, die er "Pithecanthropus" nennt. Dieser "Pithecanthropus", schreibt Dr. Euvelmans, "ist eine schamlose Fälschung."
Ein Foto des auf einer Kiste sitzenden Lua-Affen wurde aufgenommen, zerschnitten und in einer anderen Position vor der Kulisse eines Urwaldes wieder zusammengesetzt, aber so, dass nun deutlich sichtbar war, dass das Tier keinen Schwanz hatte.
Die Zeichnung des „Pithecanthropus“ von Courteville auf Packpapier ist nicht mehr glaubwürdig. Laut Euvelmans sieht die von Courteville gezeichnete Kreatur eher wie ein junger Gorilla aus als wie ein Lua-Affe, dessen kombiniertes Foto auf den folgenden Seiten platziert ist. Es gibt viele biologische Absurditäten in der Beschreibung des Tieres, dem Courteville angeblich begegnet ist.
Kurupira, Maribunda, Pelobo - wer sind sie?
Falschmeldungen und Fälschungen skrupelloser Forscher haben dem Prestige des Lua-Affen großen Schaden zugefügt. Inzwischen ist die Fotografie ein unbestreitbarer Beweis für ihre reale Existenz. Auf dem Foto sehen wir einen sehr großen Affen, ähnlich einem Mantel, aber den Zoologen unbekannt.
Gerüchte über solche Affen sind in den Wäldern des Amazonas weit verbreitet. Die ersten Entdecker Südamerikas, Alexander Humboldt und Henry Bates, berichteten von den mit Wolle bedeckten Wald-„Menschen“, deren Bräuche sehr an die Gewohnheiten großer Affen erinnern.
Bates spricht zum Beispiel über das mysteriöse Waldwesen Curupira, das große Angst vor den brasilianischen Indianern hat. „Manchmal wird er als etwas wie ein Orang-Utan dargestellt, der mit langem, struppigem Haar bedeckt ist und auf Bäumen lebt. An anderen Stellen heißt es, er habe unten gespaltene Beine und ein knallrotes Gesicht. Er hat eine Frau und Kinder. Manchmal geht er hinaus auf die Plantagen, um Maniok zu stehlen."
Bates sagt, dass der Curupira als Kobold verehrt wird. Spirituosen stehlen jedoch keinen Maniok!
Kürzlich wurden Goldgräber, die in die endlosen Wälder vordrangen, durch die der Fluss Araguaia kaum seinen Weg findet, von einem schrecklichen Gebrüll erschreckt, das in den Tiefen der wilden Selva zu hören war. Am nächsten Morgen fanden sie ihre Pferde tot vor: Jedem war die Zunge herausgerissen. Auf dem nassen Sand in der Nähe des Flusses bemerkten verängstigte Menschen eine Spur riesiger „menschlicher“ Beine mit einer Länge von 21 Zoll (52,5 Zentimeter).
Über diesen Fall berichtet der englische Naturforscher Frank Lane. Die Geschichte ähnelt jedoch den Handlungen fantastischer Geschichten.
Doch was wissen wir über das Leben in den gigantischen, völlig unerforschten Wäldern des geheimnisvollen Mato Grosso, dem westlichen Bundesstaat Brasiliens?
Die östliche Grenze von Mato Grosso verläuft entlang des Flusses Araguaia. Vielleicht leben dort ein paar unbekannte Affen, so groß und stark wie Gorillas. Seit langem ist von amerikanischen „Gorillas“ die Rede. Missionare aus dem Amazonas berichteten über sie, noch bevor Savage afrikanische Gorillas beschrieb.
Auf der Halbinsel Yucatan (in Mexiko) haben Archäologen seltsame Steinstatuen gefunden, die ... Gorillas sehr ähnlich sind. Kürzlich wurden unter den Felsskulpturen Südamerikas Figuren gefunden, die sogar Elefanten, Löwen und anderen afrikanischen Tieren ähneln. Dies beweist jedoch noch nicht, dass die Tiere, die lokalen Bildhauern als Modelle dienten, wirklich in den Wäldern Amerikas leben (oder in jüngerer Zeit gelebt haben).
Überraschende Funde zeugen vielmehr von kulturellen Bindungen zwischen den Völkern Amerikas und Afrikas, die lange vor der Entdeckung der Neuen Welt durch die Europäer bestanden.
Und doch reißen die Gerüchte über angeblich in der Wildnis Südamerikas lebende Menschenaffen bis heute nicht ab. Bernard Euvelmans sammelte viele Berichte über verschiedene Pelobo, Mapinguari, Pedegarrafa, Maribunda und andere seltsame "humanoide" Kreaturen, die nach südamerikanischen Legenden in den Regenwäldern von Brasilien, Venezuela, Kolumbien und Bolivien leben.
Von allen Berichten haben die Geschichten von de Vavrin, dem neuesten Entdecker Südamerikas, den größten wissenschaftlichen Wert. In seinem 1951 in Paris erschienenen Buch Wilde Tiere des Amazonas schreibt er:
„Ich habe mehr als einmal von der Existenz von Menschenaffen in den riesigen Wäldern im Norden von Mato Grosso an der Wasserscheide zwischen dem Amazonasbecken und dem Becken von Paraguay gehört. Ich habe sie selbst nicht gesehen. Aber überall in den heimischen Wäldern hört man viele Geschichten über sie. Noch hartnäckigere Gerüchte gibt es im Orinoco-Becken.
Diese Affen werden Maribunda genannt. Ihre Höhe beträgt etwa 1 Meter 50 Zentimeter. Ein Anwohner aus dem Oberlauf des Guaviare erzählte mir, dass er in seinem Haus ein Maribunda-Junges aufgezogen hat. Es war ein sehr freundliches und lustiges Tier. Aber als er aufwuchs, musste er getötet werden, weil er mit seinen Streichen großen Schaden anrichtete.
Der Schrei der Maribunda erinnert sehr an eine menschliche Stimme. Als ich durch das Dickicht des Waldes wanderte, hielt ich es selbst mehr als einmal für den Ruf der Indianer.
Einmal, im Oberlauf des Orinoco, säte die Maribunda Panik in de Wavrens Lager. Die Träger verwechselten ihre Schreie mit dem Schlachtruf der kriegerischen Guaharibo-Indianer.
Vielleicht sind die Maribunda Lua-Affen?
Für eine solche Behauptung gibt es keine hinreichenden Gründe. Der „Fall“ des mysteriösen Affen, der auf einer Kerosinkiste fotografiert wurde, ist noch nicht endgültig gelöst. Nur eines ist klar: Das ist kein Menschenaffe.
In den Tiefen der Wolkenstein warten Forscher offenbar noch immer auf spannende Begegnungen mit diesen unfreundlichen Tieren, die uns bislang nur aus dem „Portrait“ bekannt sind.
Warum ist es wichtig?
Der Fang und die Erforschung des Lua-Affen ist nicht nur aus rein biologischer Sicht interessant.
Jetzt, wo der endgültige Zusammenbruch des Kolonialismus naht und die Bastionen der jahrhundertealten Sklaverei der unterdrückten Völker zerbröckeln, verschmähen die Kolonialisten kein Mittel, um den mächtigen Aufschwung der nationalen Befreiungsbewegung in den Ländern Asiens, Afrikas zu ersticken und Amerika. Wissenschaftsfälschung, die Ideologen des Kolonialismus und die Prediger des tollwütigsten Rassismus versuchen mit Hilfe weit hergeholter „Theorien“ in den Augen zu rechtfertigen öffentliche Meinung ihre Eroberungspläne.
Die reaktionärsten bürgerlichen Wissenschaftler haben zahlreiche Hypothesen über Ologenismus, Polygenismus, Dichotomismus und ähnliche Erfindungen aufgestellt. Ihre Autoren sind unterschiedlich, aber das Ziel ist das gleiche - den Anschein von Beweisen zu erwecken, dass eine Person angeblich von verschiedenen Vorfahren abstammt. Moderne Völker, die verschiedene Kontinente und Inseln bewohnen, sind keine Blutsbrüder und Ursprünge, wie die Wissenschaft seit langem feststellt, sondern, sehen Sie, völlig unterschiedliche Arten und sogar angebliche Gattungen von Lebewesen. Unterschiedliche Herkunft impliziert offensichtlich unterschiedliche Fähigkeiten. Daher, so die Rassisten, werden einige Völker, die höheren, von der Natur selbst dazu berufen, die Erde zu beherrschen, während andere, die niedrigeren, aufgrund ihrer anfänglichen Unterlegenheit zur Sklaverei und Auslöschung verurteilt sind.
Für die Verteidiger dieses kannibalischen Konzepts wäre der amerikanische Menschenaffe ein Fund von unschätzbarem Wert. Schließlich wurden in Amerika noch keine Spuren von Menschenaffen gefunden – weder heute noch in ferner Vergangenheit. Rassistische Theorien, dass Indianer von einheimischen Menschenaffen abstammen, liegen in der Luft. Reaktionäre Anthropologen nutzen schon seit langem jeden Vorwand und erfinden alle möglichen amerikanischen Affen und "Pithecanthropes", um diese Lücke in ihren Erfindungen zu füllen. Der Fall des Lua-Affen ist nicht der einzige.
Der skandalöse Vorfall mit einem anderen amerikanischen "Anthropoiden" ereignete sich sogar noch früher, im Jahr 1922. In den alten Schichten des Landes Wyoming (ein Bundesstaat im Westen der Vereinigten Staaten) wurde ein Backenzahn eines fossilen Menschenaffen gefunden - so definierten zumindest die größten amerikanischen Paläontologen diesen Fund. Es war eine grandiose Sensation, die die gesamte wissenschaftliche Welt erschütterte. Das „primitive Mitglied der menschlichen Familie“, wie einige amerikanische Zoologen den hypothetischen Besitzer des Zahns nannten, hieß Hesperopithecus. Der deutsche reaktionäre Wissenschaftler Franz Koch beeilte sich, Hesperopithecus als Vorfahren der arischen Rasse zu registrieren, die natürlich einen besonderen Ursprung haben muss.
Aber wie erwartet haben gründlichere Studien gezeigt, dass der berüchtigte Zahn nicht zu einem Menschenaffen gehört, sondern ... zu einem wilden fossilen Schwein aus der Gattung Prostenops (Schweine- und menschliche Backenzähne sind sich sehr ähnlich).
Was für ein Skandal! „Bei den Vorfahren der arischen Rasse“, schreibt Professor M. F. Nesturkh, „gab es ein fossiles nordamerikanisches Schwein.“
Aber die Lektion kam nicht den Scharlatanen aus der Wissenschaft zugute. Sieben Jahre nach Hesperopithecus wurden der "Ameranthropoid Lua" und seine modifizierte Version im Werk von Courteville erfunden. Es wird offensichtlich andere Fälschungen geben.
Es besteht jedoch kein Zweifel, dass weder der Lua-Affe noch andere fälschlicherweise als amerikanische „Anthropoide“ bezeichnete amerikanische „Anthropoide“ wie Hesperopithecus oder der Homunculus des argentinischen Paläontologen Ameghino tatsächlich zu den Menschenaffen gehören. Es kann als erwiesen angesehen werden, dass die Vorfahren der Indianer vor relativ kurzer Zeit, vor ungefähr 25.000 Jahren, von Asien über die Landenge, die die Tschuktschen-Halbinsel und Alaska während der Eiszeit verband, nach Amerika gezogen sind. In Amerika gab es kein unabhängiges Zentrum menschlichen Ursprungs.
Es ist möglich, dass in derselben ereignisreichen Ära nach Menschen, Bisonherden und Mammuts ein weiteres mysteriöses Wesen von Asien nach Amerika zog - der Bruder des Bigfoot.
Hier ist, was sie über ihn sagen.
"Kobold" von Arroyo Bluff
27. August 1958 Gerald Crewe machte sich für die Arbeit fertig. Er arbeitete als Traktorfahrer beim Bau einer neuen Autobahn im Humboldt County (im äußersten Nordwesten Kaliforniens).
Sein Weg führte durch das Tal von Arroyo Bluff. Rundherum war ein wildes, unbewohntes Gebiet - felsige Seifen und Nadelwälder an den Hängen der Berge.
Nachdem er sich im Fluss gewaschen hatte, in dessen Nähe sich das Bauarbeiterlager befand, ging J. Crew zu seinem Traktor und blieb plötzlich stehen.
Trotzdem - immerhin stolperte er über die Spuren von ... einem "Schneemann", der, wie man so sagt, im Schnee des Himalaya umherwandert!
Aber Kalifornien ist hier - ein Land der modischen Resorts, Orangenplantagen und der größten Filmstudios der Welt ...
Als Gerald Crew wieder zur Besinnung kam, maß er die Abdrücke riesiger nackter Füße, die eine unbekannte Kreatur auf Lehmboden hinterlassen hatte. Vierzig Zentimeter - die Länge des Fußes! Und die Schrittlänge beträgt 115-175 Zentimeter.
Der Traktorfahrer wagte es, der Spur ein Stück weit zu folgen. Die Gleise führten fast von einem steilen Abhang herunter (ca. 80°!), führten um die Arbeitersiedlung herum und verschwanden im Wald hinter dem Hügel.
J. Crew hatte zuvor von seinen Kameraden von denselben seltsamen und riesigen Fußabdrücken gehört, die an den Ufern des Mad River (der nördlich von Humboldt Bay in den Pazifischen Ozean mündet) gesehen wurden.
Im September 1958 tauchte die mysteriöse Kreatur in der Nähe des Arbeiterlagers wieder auf. Die Frau eines der Handwerker schrieb einen Brief an die Lokalzeitung The Humboldt Times:
„Es gibt Gerüchte unter den Arbeitern, dass der Mann der Wälder existiert. Was hast du davon gehört?"
Der Brief wurde in der Zeitung abgedruckt. Die Herausgeber begannen, Briefe von anderen Lesern zu erhalten. Viele von ihnen behaupteten, sie hätten den „Paton“ – so wurde der struppige Riese hier genannt – mit eigenen Augen gesehen.
Zu diesem Zeitpunkt stieß J. Crew erneut auf mysteriöse Fußabdrücke im Tal von Arroyo Bluff und fertigte Gipsabdrücke davon an. Die Humboldt Times platzierte Fotografien dieser Abgüsse auf der Titelseite. Das Material wurde von anderen Zeitungen nachgedruckt. Aus aller Welt regnete ein Hagel von Briefen, Telegrammen, Fragen.
Wissenschaftler interessierten sich auch für seltsame Ereignisse. Der amerikanische Zoologe und Paläontologe Ivan Sanderson traf am Tatort ein. Er befragte Augenzeugen, untersuchte die Gipsabdrücke und fand eine Reihe neuer interessanter Umstände heraus. Über die gesammelten Informationen berichtete er in mehreren Artikeln. Eine davon wurde in der kubanischen Zeitschrift „Boemia“ (in der ersten Ausgabe von 1960) veröffentlicht.
Hier ist, was Ivan Sanderson festgestellt hat.
Der Unternehmer, der den Auftrag für den Bau der Autobahn erhielt, dachte zunächst, dass einer der Anwohner die Arbeiter einschüchterte, um den Bau der Straße zu stören. Dieser Betrüger besaß jedoch anscheinend übermenschliche Kräfte. Er nahm zum Beispiel ein Stahlfass mit Dieselkraftstoff mit einem Fassungsvermögen von 250 Litern aus einem Lagerhaus und warf es in eine abgelegene Schlucht. Dann schleppte er ein Stahlrohr und ein Rad von einem Bagger in den Wald. Ray Wallace, ein Unternehmer, stellte zwei Detektive ein. Sie mussten den Eindringling aufspüren und fangen.
Im Glauben, dass Zeit Geld ist, holten Ray Kerr und Bob Briton Bluthunde und begannen sofort mit der Suche. Aber die Aufgabe erwies sich als nicht so einfach, und die Detektive begannen ernsthaft zu glauben, dass sie viel mehr Zeit als Geld haben würden, wenn ihre Angelegenheiten so weitergingen.
Aber dann, eines Tages im Oktober 1959, kehrten nach Sonnenuntergang zwei Sherlock Holmes von einem weiteren Suchangriff zurück.
Plötzlich bemerkten sie am Rand der Forststraße ein struppiges humanoides Wesen. Es war "patenieren"! Mit zwei Sprüngen sprang er über die Straße und verschwand im Gebüsch.

Die Hunde, mit denen die Ermittler ihm folgen wollten, sind verschwunden. Sie sagen, dass sie ihre angenagten Knochen später im Wald gefunden haben.
Es wird weiter gesagt, dass ein Ehepaar mit seinem eigenen Flugzeug über dieses Gebiet geflogen ist. In den Bergen lag noch Schnee. Das Paar, obwohl sie miteinander beschäftigt waren, bemerkte jedoch unten etwas: einen riesigen, struppigen Riesen, der barfuß im Schnee lief und eine lange Reihe von Fußspuren hinter sich ließ.
Eine Dame und ihre Tochter trafen zwei Patons im Hupa-Tal. Und im August 1959 sahen zwei Anwohner 23 Meilen nördlich der neuen Autobahn erneut Spuren von Monstern. Sie fanden sogar ihre Wolle, die in Büscheln an den Zweigen von Tannen und an der Rinde von Kiefern in einer Höhe von etwa zwei Metern über dem Boden klebte. Die Länge der Haare war unterschiedlich - von 2 bis 27 Zentimeter.
Unter den Bäumen fanden sie das Versteck des Patons, wo er die Nacht verbrachte. Es wurde aus Moos und Zweigen gebaut. Paton entfernte Moos und Flechten von Bäumen.
Betty Allen, Korrespondentin der Humboldt Times, sprach mit einheimischen Indianern.
Heiliger Gott! Sie waren überrascht. „Lassen Sie die Weißen endlich davon erfahren!“
Früher gab es an diesen Orten mehr Patons. Es wird gesagt, dass sie einmal angeblich sogar ein Bergbaudorf in der Nähe des Clear River (südwestliches Oregon) angegriffen, ein Lagerhaus mit Lebensmittelvorräten verwüstet und drei Arbeiter getötet haben sollen. Während des Goldrausches von 1848-1849 vernichteten Massen von Abenteurern, die nach Kalifornien kamen, viele Patons und trieben sie in die fernen Wälder. Nur sehr wenige von ihnen überlebten.
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus diesen Berichten ziehen? fragt Ivan Sanderson.
Die Zeit ist vorbei, in der Zoologen einstimmig eine fantastische haarige Gestalt verspotteten, die unerwartet auf den eisigen Gipfeln des Himalaya auftauchte, wie ein Geist aus der fernen Vergangenheit unseres Planeten.
Seltsame Berichte über alle möglichen "wilden Menschen" kommen jetzt von den unerwartetsten Orten - aus Malaya, Indonesien, Nordwestchina, aus der Mongolei, aus dem Pamir, aus Transbaikalien, sogar aus dem Kaukasus und schließlich aus Kalifornien.
Die Wissenschaftler, die dies intensiv untersucht haben interessantes Problem, fand "Spuren" eines wilden Mannes sogar in der antiken Literatur und mittelalterlichen Manuskripten Westeuropas.
Es scheint, dass diese angeblichen Menschenaffen erst vor kurzem, vor etwa 400-500 Jahren, sehr weit verbreitet waren. Die Erfindung der Feuerwaffen markierte den Beginn ihrer Massenvernichtung.
Es ist möglich, dass die Geschichten über verschiedene Arten von Almesty, Almas und Kaptar, die von den Bewohnern des Kaukasus, Zentralasiens und der Mongolei zu hören sind, verspätete Erinnerungen an vergangene Zeiten sind, als diese „Kobolde“ aus Fleisch und Blut Seite lebten an der Seite des Menschen.
Es ist auch möglich, dass sie in einigen abgelegenen Ecken bis heute überlebt haben. Nordwestkalifornien und Südwestoregon sind einer der möglichen Lebensräume für diese unbekannten Kreaturen, die während der Eiszeit aus Asien hierher gezogen sein könnten, da in Amerika keine anthropoiden Fossilien gefunden wurden.
„In der Nähe von Arroyo Bluff“, schreibt Ivan Sanderson, „gehen sicherlich seltsame Dinge vor. Eine mysteriöse Kreatur schafft es, Stahlfässer mit Öl, Eisenrohre und Räder von Ort zu Ort zu bewegen. Er erklimmt mühelos steile Hänge, knurrt laut und hinterlässt vierzig Zentimeter lange Spuren.
Es besteht kein Zweifel, dass diese Spuren wirklich existieren. Sie wurden von keinem Betrüger fabriziert: Es gibt ziemlich starke Beweise dagegen.
Der äußerste Nordwesten Kaliforniens erstreckt sich über mehr als 100 Quadratmeilen. Bis vor kurzem war dieses Gebiet unbewohnt. Das Gebiet ist mit dichten und undurchdringlichen Wäldern bedeckt und für die Luftbeobachtung nicht zugänglich (mit Ausnahme der höchsten Berggipfel).
Diese Orte wurden von niemandem erforscht. Nicht einmal detaillierte Karten wurden erstellt. Im Zentrum der Zivilisation gibt es einen völlig wilden Ort und wahrscheinlich lebt dort eine unbekannte und mysteriöse Kreatur.
Allerdings stimmen nicht alle amerikanischen Zoologen der Meinung von Ivan Sanderson zu, dass "es genügend Beweise dafür gibt", dass die Paton-Spuren nicht von einem Betrüger fabriziert wurden.
Ich habe gerade einen Brief vom American Museum of Natural History von Dr. Joseph Moore vor mir, der schreibt, dass er und seine Kollegen die Berichte von Arroyo Bluff Bigfoot mit großer Skepsis prüfen.
Materialien, die das Museum aus Kalifornien erhalten hat, liefern "ausreichend starke Beweise nur dafür, dass dies nichts weiter als ein Witz ist, und wir sehen vorerst davon ab, darüber zu diskutieren".

Trotzdem entschied sich Tom Slick, der Organisator der amerikanischen Himalaya-Yeti-Expeditionen, sein Glück in Kalifornien zu versuchen. Kürzlich war er in Moskau und sagte, er habe Spezialisten zur Aufklärung nach Arroyo Bluff geschickt.
Agogwe - "Schneemänner" Afrikas
Eines der ungelösten Geheimnisse der afrikanischen Wildnis, schreibt der britische Naturforscher Frank Lane, sind kleine Wald-„Männer“ – Agogwe.
Seltsame Kreaturen sind nicht größer als vier Fuß (etwa 1 Meter 20 Zentimeter), ihr ganzer Körper ist mit roten Haaren bedeckt, ihr Gesicht ist ein Affe, aber sie gehen auf zwei Beinen wie Menschen.
Agogwe leben in den Tiefen undurchdringlicher Wälder. Selbst ein erfahrener Jäger hat kaum eine Chance, sie zu sehen. Das passiert nur einmal im Leben, sagen Einheimische. Gerüchte über Aggwe verbreiteten sich über ein Gebiet von mehr als 1000 Kilometern – vom Südwesten Kenias bis nach Tanganjika und weiter bis nach Mosambik.
Auch europäische Reisende berichten von kleinen Wald-„Männern“. Kapitän Hichens, ein Beamter der britischen Verwaltung in Kenia, sammelte während eines langen Dienstes in Afrika viele Informationen über die mysteriösen, der Wissenschaft unbekannten Tiere, an deren Existenz die Einheimischen glauben. In dem 1937 in der englischen Wissenschaftszeitschrift „Discovery“ („Discovery“) veröffentlichten Artikel „African Mysterious Animals“ schreibt er über Agogwe:
„Vor einigen Jahren erhielt ich einen Jagdauftrag, um einen menschenfressenden Löwen in den Wäldern von Issur und Simbiti am westlichen Rand der Vembara-Ebene zu erlegen. Als ich einmal auf einer Waldlichtung im Hinterhalt auf einen Kannibalen wartete, kamen plötzlich zwei kleine braune Kreaturen aus dem Wald und versteckten sich in einem Dickicht auf der anderen Seite der Lichtung. Sie sahen aus wie winzige Männer von etwa vier Fuß Höhe, gingen auf zwei Beinen und waren mit roten Haaren bedeckt. Der einheimische Jäger, der mich begleitete, erstarrte überrascht mit offenem Mund.
Das ist Aggwe“, sagte er, als er ein wenig zur Besinnung kam.
Hichens verbrachte viel Zeit damit, die kleinen "Männer" wiederzusehen. Aber es ist leichter, eine Nadel im Heuhaufen zu finden als ein flinkes Tier in diesem unwegsamen Dickicht!
Hichens versichert, dass die Kreaturen, die er sah, nicht wie die Affen waren, die er kannte. Aber wer sind sie?
Einige Jahre zuvor veröffentlichte das Journal of the Natural Science Society of East Africa and Uganda den folgenden Bericht: „Die Eingeborenen der Region Kwa Ngombe behaupten, dass ihre Berge von Büffeln, Wildschweinen und einem Stamm kleiner roter „Männer“ bewohnt werden. die eifersüchtig ihren Bergbesitz bewachen. Der alte Salim, ein Führer aus Embu, sagte, er sei einmal mit ein paar Gefährten hoch in die Berge geklettert. Wir sind fast ganz oben angekommen, hier hat es geweht Kalter Wind. Plötzlich regnete ein ganzer Steinhagel von oben auf die Jäger nieder. Sie nahmen Reißaus. Als er zurückblickte, sah der alte Salim zwei Dutzend kleine rothaarige „Männer“, die von der Spitze einer steilen Klippe Steine auf sie warfen.
Hier sind weitere Geschichten über die kleinen rothaarigen „Männer“ Afrikas.
Ein Reisender sah sie von einem Schiff aus, das vor der Küste Mosambiks in Begleitung von Pavianen segelte. Ein anderer begegnete in den Tiefen desselben Landes einer ganzen Agogwe-Familie: Mutter, Vater und Jungtier. Die ihn begleitenden einheimischen Jäger protestierten heftig, als er einen der Liliputaner erschießen wollte.
Hast du gehört, - fragte sein Knappe den Jäger Kotney, - von den kleinen Männern, die am Mai leben? Über kleine Leute, die eher wie Affen als wie Menschen sind?
Und er erzählte, wie sein Vater einst von den „Zwergen“ des Mai gefangen genommen wurde, als er an den Hängen des Mount Longonot Schafe hütete. Er verfehlte ein Schaf und folgte seiner blutigen Spur. Plötzlich, aus dem Nichts, umgaben ihn seltsame kleine Kreaturen, kleiner als die „Waldmenschen“ (dh Pygmäen), sie hatten keine Schwänze, aber sie sahen eher aus wie Affen, die durch Bäume springen, als wie Menschen. Ihre Haut ist so weiß wie der Bauch einer Eidechse, aber ihr Gesicht und ihr Körper sind mit langen schwarzen Haaren überwuchert.
Mit Hilfe seines Speers beseitigte der Hirte die gefährliche Gesellschaft militanter „Zwerge“.
Das Auffälligste ist, dass die kleinen Wald-Männer, wie sie Gerüchte zeichnen, sehr an ausgestorbene Affen erinnern, die Paläontologen wohlbekannt sind ...
Vor 500-800.000 Jahren lebten kleine haarige "Männer" wirklich in den Ebenen Südafrikas. In kleinen Gruppen zogen sie durch die Flusstäler, jagten Hasen, Paviane und sogar Antilopen, die von der ganzen „Gesellschaft“ zusammengetrieben wurden. Paviane und Antilopen wurden von haarigen „Männchen“ getötet, indem ihnen mit scharfen Steinen der Schädel eingeschlagen wurde.
1924 fanden Kalksteinarbeiter in der östlichen Kalahari den versteinerten Schädel eines dieser prähistorischen Affen. Seitdem haben Anthropologen Dutzende ihrer Schädel, Zähne und Knochen untersucht.
Der südafrikanische Biologe Raymond Dart nannte die fossilen „kleinen Männer“ Australopithecus („südliche Affen“), nachdem er den ersten Fund aus der Kalahari untersucht hatte. Sie waren erstaunliche Affen! Sie lebten auf dem Boden, gingen nur auf zwei Beinen und hatten fast menschliche Körperproportionen.
Ihre Zähne waren mehr Menschen als Affen. Selbst in Bezug auf die Gehirngröße waren sie Menschen näher als Affen. Bei einem fünfjährigen Australopithecus-Jungtier betrug die Schädelkapazität 420 und bei einem erwachsenen Australopithecus 500-600 Kubikzentimeter - fast doppelt so viel wie bei einem Schimpansen und nicht weniger als bei einem Gorilla! Aber Australopithecus waren viel kleiner als diese Affen. Ihr Wachstum überschritt durchschnittlich 120 Zentimeter nicht und ihr Gewicht - 40-50 Kilogramm.
Einige Wissenschaftler vermuten sogar, dass Australopithecus sprach und wusste, wie man Feuer benutzt. Daher betrachten sie sie als die ältesten Vorfahren des Menschen.
„Aber“, schreibt M. F. Nesturkh, „es gibt keine Fakten, die für eine solche Annahme sprechen. Es gibt keinen Grund“, sagt er, „diese Affen als unsere Vorfahren zu betrachten.“
Sind Australopithecinen wirklich ausgestorben, fragen einige romantische Zoologen? Vielleicht verdanken die Gerüchte über die „Mai-Zwerge“, über die Wald-Männchen Agogwe ihren Ursprung dem Australopithecus, der in der Wildnis der Urwälder überlebte? Verfolgt von ihren stärkeren und weiter entwickelten „Vettern“ – den Menschen der Steinzeit, konnten sie sich vor ihrer Verfolgung im undurchdringlichen Dickicht und auf den Gipfeln der Berge verstecken, die in Afrika völlig unbewohnt sind und selten von Menschen besucht werden: es ist zu kalt für einen Afrikaner. Immerhin passierte anscheinend etwas Ähnliches mit dem Bigfoot in Asien.

Leopardenhyäne, eselgroße Katze und Beuteltiger
Wolf oder Mischling
Raubtiere sind den Menschen besser bekannt und besser untersucht als Affen. Schließlich musste ein Mensch oft gegen Raubtiere kämpfen und sein Vieh und sein Leben vor ihren Angriffen schützen. Wohl oder übel studierte er seine Feinde gut.
Rinderzüchter und Jäger aller Länder kennen die Gewohnheiten der Raubtiere ihrer Heimat. Daher sind es Raubtiere, die am schwierigsten der Aufmerksamkeit von Naturforschern entkommen. Und doch erwarten Zoologen auch in der Welt der Raubtiere manchmal Überraschungen.
Eine der neuesten „Überraschungen“ ist ein Bergwolf aus den südamerikanischen Kordilleren. Die Geschichte seiner Entdeckung ist voll von unerwarteten Entdeckungen und bitteren Enttäuschungen.
1927 kaufte der Direktor des Hamburger Zoos, Lorenz Hagenbeck, der Sohn und Nachfolger des Werks von Karl Hagenbeck, das Fell eines unbekannten Wolfs in Buenos Aires. Der Mann, der es verkaufte, sagte, es sei ein "Bergwolf", der hoch oben in der Kordillere getötet wurde. Keiner der Experten konnte feststellen, zu welchem Tier diese Haut tatsächlich gehört. Sie reiste lange von einem Museum in Deutschland zum anderen und landete schließlich in München.
Nach 14 Jahren wurde sie hier von einem großen Säugetierkenner, Dr. Krumbigel, gesehen. Nach langem Überlegen kam er zu dem Schluss, dass die Haut offenbar zu einer Art Gebirgssorte des Mähnenwolfs gehörte. Der Mähnenwolf lebt in den Wüstenebenen von Paraguay, Bolivien, Nordargentinien und Südbrasilien. Es wurde auch vor relativ kurzer Zeit entdeckt und ist immer noch wenig verstanden. Es hat sehr lange Beine und Ohren und eine kleine Mähne wächst auf dem Genick und auf dem Rücken. Es ist bekannt, dass der Mähnenwolf nachts hauptsächlich auf verschiedene Kleintiere jagt, er ernährt sich auch von Früchten.

Das Fell eines unbekannten Tieres, das Hagenbeck nach Krumbiegel-Forschungen mitbrachte, wurde unter dem Namen „Mähnenwolf-Bergrasse“ in den Katalog des Münchner Museums aufgenommen.
Einige Jahre später war Hagenbeck wieder in Argentinien. Auf irgendeinem Markt sah er drei weitere der gleichen Felle; aber für seltene Felle verlangten sie zu viel, und er kaufte sie nicht.
Etwa zur gleichen Zeit erinnerte sich Dr. Krumbigel beim Durchsehen seiner alten Notizen daran, dass er in einer der Sammlungen südamerikanischer Säugetiere irgendwie den Schädel eines Wolfs gefunden hatte, der sich von allen der Wissenschaft bekannten Arten unterschied. Eine alte Arbeit, die die Zeichen eines seltsamen Schädels beschreibt, die der Wissenschaftler in seinem Archiv fand, machte ihn sehr glücklich. Ihm wurde klar, dass er aus dem Münchener Museum endlich den Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses der unglückseligen Haut erhalten hatte, das, wie er selbst sehr gut wusste, von ihm ungenau bestimmt worden war.

1949 veröffentlichte Krumbigel einen Aufsatz, in dem er über die Ergebnisse seiner Forschung berichtete: Schädel und Haut gehören einem Tier einer besonderen Art und Gattung an. Er nannte es Dasycyon hagenbecki. Dazition steht dem Mähnenwolf nahe, obwohl er sich stark von ihm unterscheidet. Es ist größer (die Länge der Haut mit einem Schwanz beträgt zwei Meter), gedrungener und stämmiger, mit kurzen Beinen. Es hat kleine abgerundete Ohren und ein sehr dickes und langes Fell. Auf dem Rücken erreichen die Haare eine Länge von zwanzig Zentimetern! Das Fell des Dazicyon ist dunkelbraun, das des Mähnenwolfs gelbrot, wie das unseres Fuchses. Der Mähnenwolf lebt in den offenen Ebenen, während die Dazition in den Bergen lebt.
Keiner der Europäer hat diese Bestie bisher gesehen, weder lebend noch tot. Er wurde in Teilen beschrieben und sozusagen der Wissenschaft "angehängt" - entsprechend der Haut und dem Schädel, die zu unterschiedlichen Zeiten nach Europa gebracht wurden.
In den letzten Jahren wurden jedoch Stimmen unter Fachleuten laut, die die wahre Existenz des von Krumbigel beschriebenen Wolfs leugneten. Auf solch „extravagante“ Weise geöffnet, ist das Biest ihrer Meinung nach einfach ein wilder Mischling. Im neusten Führer der südamerikanischen Säugetiere ("Catalogue of South American Mammals"), erschienen 1957, wird der Dasition nicht unter den wilden Bewohnern dieses Kontinents erwähnt. Ich schrieb mit der Bitte um Klärung an das Argentinische Museum für Naturgeschichte. Die Meinung von Prof. A. Cabrera war so, dass Hagenbecks Dazition kein Bergwolf war, sondern ein struppiger Wildhund, so etwas wie ein Scottish Shepherd Collie; zuerst fiel sie in die Hände der Schinder und dann ins Münchner Museum. Professor A. Cabrera ist der größte zeitgenössische Säugetierspezialist in Südamerika.
Aber Dr. Krumbigel ist auch ein weltberühmter Wissenschaftler. Er argumentiert, wenn er sich irren könnte, dann nur über die Herkunft der Haut, nicht aber des Schädels, der deutliche Zeichen trägt, die nichts mit der Hundegattung zu tun haben.
Leider ist es heute unmöglich, die Richtigkeit seiner Definition zu überprüfen: Die Haut des Dazition wird möglicherweise noch im Museum aufbewahrt, aber der Schädel ging während des Krieges verloren. Dieser Streit kann also nur von zukünftigen Forschern gelöst werden, die eine Trophäe von unschätzbarem Wert für die Wissenschaft wieder extrahieren müssen - den Schädel eines Cordillera-Bergwolfs oder ... eines wilden Mischlings aus den Slums von Buenos Aires.
Ende der kostenlosen Testversion.
... Riesige Vögel lebten auf der Erde - größer als ein Elefant! Ein Wassermonster, das Flusspferde verschlingt, lebt in den Wäldern des Kongo... Zoologen einer Expedition in Kamerun wurden von einem Pterodaktylus angegriffen... Der Liner Saita Clara kollidierte mit einer Seeschlange im Ozean, und das norwegische Schiff Brunsvik wurde angegriffen ein Riesenkalmar...
Was ist hier wahr, was ist Fiktion?
Wenn Sie sich für zoologische Abenteuer und verborgene Geheimnisse des Dschungels interessieren, werden Sie das Buch „Spuren seltsamer Bestien“ mit Interesse lesen. Sie erfahren etwas über Drachen von Komodo und über die schreckliche Nunda (eine Katze so groß wie ein Esel!), über den fabelhaften Phönixvogel und darüber, wie viele neue Tiere und Vögel im letzten halben Jahrhundert von Wissenschaftlern entdeckt wurden und was Andere unbekannte Kreaturen verstecken sich in der Wildnis des Waldes und den Tiefen des Meeres.unser Planet.
Auf unserer Website können Sie das Buch "Spuren unsichtbarer Bestien" von Igor Ivanovich Akimushkin kostenlos und ohne Registrierung im fb2-, rtf-, epub-, pdf-, txt-Format herunterladen, das Buch online lesen oder ein Buch in einem Online-Shop kaufen.
Einführung
Im September 1957 untersuchten japanische Zoologen ein von Walfängern gefangenes Meerestier. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Bestie um einen Gürtelzahnwal einer der Wissenschaft unbekannten Art handelte. Keith!
Dieser Fund ist symbolisch. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als die Menschheit, nachdem sie ultraschnelle Raketen geschaffen hatte, mutig in die Außenwelt zu Hause auf der Erde stürmte, wurden solche Versehen plötzlich entdeckt - "unbemerkte" Wale! Wie man sieht, ist die Tierwelt unseres Planeten noch lange nicht so gut erforscht, wie man gemeinhin behauptet. Im letzten halben Jahrhundert hat die Presse die Leser wiederholt über unbekannte Vögel, Tiere oder Fische informiert, die irgendwo in der Wildnis des Regenwaldes oder in den Tiefen des Ozeans gefunden wurden. Und wie viele große zoologische Entdeckungen sind von der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen worden! Nur Spezialisten kennen sie.
Wie lässt sich erklären, dass die Natur den Naturforschern immer noch unerwartete Überraschungen bietet?
Tatsache ist, dass es auf der Erde viele schwer zugängliche, noch fast unmöglich zu erforschende Orte gibt. Einer davon ist der Ozean. Fast drei Viertel der Erdoberfläche sind vom Meer bedeckt. Etwa vier Millionen Quadratkilometer Meeresboden sind in ungeheuren Tiefen von über sechstausend Metern begraben. Ihre düsteren Grenzen wurden nur ein paar Dutzend Mal von künstlichen Fanggeräten überfallen. Rechnen Sie nach: ungefähr eine Tiefseeschleppnetzfischerei pro 40.000 Quadratkilometer Meeresboden!
Die Inkommensurabilität dieser Zahlen überzeugt uns mehr als alle Worte davon, dass die Tiefen des Ozeans bis heute nicht wirklich erforscht wurden.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass buchstäblich jedes Schleppnetz, das auf eine beträchtliche Tiefe abgesenkt wird, notwendigerweise Tiere vom Meeresgrund mit sich bringt, die Fachleuten unbekannt sind.
1952 fischten amerikanische Ichthyologen im Golf von Kalifornien und fingen selbst hier mindestens 50 ihnen unbekannte Fischarten. Aber ein wirklich endloses Land der unerwartetsten Funde wurde von sowjetischen Wissenschaftlern entdeckt, die mit Hilfe der neuesten Ausrüstung des Forschungsschiffs Vityaz in die Tiefen des Ozeans vordrangen. Wo immer sie arbeiten mussten: Sowohl im Pazifik als auch im Indischen Ozean entdeckten sie unbekannte Fische, Tintenfische, Weichtiere und Würmer.
Sogar auf den Kurilen, die zuvor mehr als eine Expedition besucht hatte, machten sowjetische Wissenschaftler (S. K. Klumov und seine Mitarbeiter) unerwartete Entdeckungen. Auf der Insel Kunaschir wurden giftige Schlangen gefunden. Davor glaubte man, dass auf den Kurilen nur ungiftige Schlangen gefunden wurden. Hier wurden bisher unbekannte Molche, Laubfrösche und Landegel der ganz besonderen Art gefunden.
Die Zoologen der Vityaz haben noch ungewöhnlichere Kreaturen vom Meeresgrund geborgen - fantastische Pogonophoren. Dies sind Tiere, die die Natur „vergessen“ hat, mit den lebensnotwendigsten Organen auszustatten - Mund und Darm!
Wie essen sie?
Auf die unglaublichste Art und Weise - mit Hilfe von Tentakeln. Die Tentakel fangen Nahrung auf, verdauen sie und nehmen die nahrhaften Säfte auf, die durch die Blutgefäße in alle Körperteile fließen.
Bereits 1914 wurde der erste Vertreter der Pogonophora vor der Küste Indonesiens gefangen. Der zweite wurde vor 29 Jahren in unserem Ochotskischen Meer gefunden. Aber lange Zeit konnten Wissenschaftler keinen geeigneten Platz für diese seltsamen Kreaturen in der wissenschaftlichen Klassifizierung von Wildtieren finden.
Nur die Studien der Vityaz halfen, ziemlich umfangreiche Sammlungen der einzigartigsten Kreaturen zu sammeln. Nach dem Studium dieser Sammlungen kamen Zoologen zu dem Schluss, dass Pogonophoren keiner der neun größten zoologischen Gruppen - den sogenannten Arten des Tierreichs - angehören. Pogonophoren bildeten einen besonderen, zehnten Typ. Ihre Struktur ist so ungewöhnlich.
Pogonophoren kommen heute in allen Ozeanen vor, sogar in der Arktis. Sie sind auf der ganzen Welt verbreitet und auf dem Meeresgrund offenbar gar nicht selten. A. V. Ivanov, ein Leningrader Zoologe, dem die Wissenschaft die gründlichsten Studien über Pogonophora verdankt, schreibt, dass diese Tiere in vielen ihrer Lebensräume äußerst häufig vorkommen. „Schleppnetze bringen viele gefüllte und leere Pogonophor-Röhren hierher, verstopfen den Schleppnetzsack und hängen sogar am Rahmen und Kabel.“
Warum fielen bis vor kurzem so viele Kreaturen nicht in die Hände von Meeresforschern? Und es ist nicht schwer, sie zu fangen: Pogonophoren führen einen bewegungslosen Lebensstil.
Ja, weil sie nicht mitbekommen haben, dass Wissenschaftler gerade erst anfangen, wirklich in die Tiefen der Ozeane und Meere vorzudringen. Natürlich erwarten uns hier viele der erstaunlichsten Entdeckungen. Bisher wurde nur ein kleiner Teil der Meerestiere untersucht. Die größten und beweglichsten Bewohner der Tiefe sind mit den üblichen Werkzeugen von Fischerei- und Expeditionsschiffen überhaupt nicht zu fangen. Schleppnetze, Netze, Netze sind dafür einfach nicht geeignet. Manche Forscher sagen deshalb: „Im Ozean ist alles möglich!“
Es gibt einen anderen Ort auf der Erde, an dem sich dem Naturforscher von den ersten Schritten an vielversprechende Möglichkeiten eröffnen. Aber seine Geheimnisse zu durchdringen ist nicht einfacher, als in den Abgrund des Ozeans einzudringen. Nicht Tiefen und nicht einmal transzendente Höhen schützen diesen Ort, sondern ganz andere Hindernisse. Es gibt sehr viele von ihnen, und sie sind alle gefährlich.
Es geht um den Tropenwald. Die raue Antarktis ist berühmt für ihre Unzugänglichkeit. Aber in seinem Schnee kann man sich, obwohl mit unglaublichen Schwierigkeiten, in speziell ausgestatteten Fahrzeugen fortbewegen. Im Regenwald bleibt jeder Geländewagen gleich am Anfang stecken.
Ein Mensch kann hier nur mit den Transportmitteln, die ihm die Natur gegeben hat, das Ziel erreichen. Welche Prüfungen ihm bevorstehen, erfahren wir im nächsten Kapitel.
Schwarze Albträume und „weiße Flecken“ des Dschungels
Die Schrecken der „Grünen Hölle“
„Jemand sagte“, schreibt Arkady Fidler, „dass es für eine Person, die den Dschungel betritt, nur zwei angenehme Tage gibt. Der erste Tag, an dem er, geblendet von ihrer bezaubernden Pracht und Macht, glaubt, in den Himmel gekommen zu sein, und der letzte Tag, an dem er, dem Wahnsinn nahe, aus dieser grünen Hölle flieht.
Warum ist der Tropenwald so schrecklich?
Stellen Sie sich einen riesigen Ozean aus riesigen Bäumen vor. Sie wachsen so eng zusammen, dass sich ihre Spitzen zu einem undurchdringlichen Gewölbe verflechten.
Fantasievolle Schlingpflanzen und Rattans verflochten den ohnehin schon undurchdringlichen Dschungel mit einem dichten Netz. Baumstämme, knotige Rebententakel sind mit Moosen, riesigen Flechten bewachsen. Moos ist überall - sowohl auf verrottenden Stämmen als auch auf winzigen, mit einem "Taschentuch" versehenen Landstücken, die nicht von Bäumen besetzt sind, und in schlammigen Bächen und Gruben, die mit dicker schwarzer Gülle gefüllt sind.
Nirgends ein Grasbüschel. Überall Moose, Pilze, Farne, Schlingpflanzen, Orchideen und Bäume; die Bäume sind monströse Riesen und schwache Zwerge. Alle drängen sich im Kampf ums Licht, klettern aufeinander, verflechten sich, winden sich hoffnungslos, bilden ein unwegsames Dickicht.
Ringsum herrscht eine graugrüne Dämmerung. Es gibt keinen Sonnenaufgang, keinen Sonnenuntergang, keine Sonne selbst am Himmel.
Kein Wind. Nicht einmal der leiseste Atemzug. Die Luft ist regungslos wie in einem Gewächshaus, gesättigt mit Wasser- und Kohlendioxiddämpfen. Es riecht nach Fäulnis. Die Feuchtigkeit ist unglaublich - bis zu 90-100 % relative Luftfeuchtigkeit!

Und die Hitze! Das Thermometer zeigt tagsüber fast immer 40°C über Null an. Heiß, stickig, feucht! Sogar die Bäume, ihre harten, wie Wachs, Blätter waren mit "Schweiß" bedeckt - große Tropfen eingedickten Feuchtigkeitsdampfes. Tropfen laufen übereinander, fallen von Blatt zu Blatt in einem unaufhörlichen Regen, Tropfen klingen überall im Wald.
Nur am Fluss kann man frei atmen. Nachdem er eine Bresche in den monströsen Haufen lebender und toter Bäume geschlagen hat, bringt der Fluss Kühle und Frische in den muffigen Abgrund der Wildnis.

Deshalb gingen alle Expeditionen, die in die Wildnis des Regenwaldes vordrangen, hauptsächlich entlang der Flüsse und entlang ihrer Ufer. Selbst die Bambuti-Pygmäen, die allem Anschein nach besser an das Leben in der Wildnis des Waldes angepasst sind als andere Völker, vermeiden es, sich weit von den Flusstälern, diesen „Autobahnen“ des Regenwaldes, zu entfernen. Auch wandernde, sogenannte Waldindianer, wie der Stamm der Campa, kommen nicht weit in die schreckliche "Selva". Bei ihren Bewegungen durch die Wälder des Amazonas folgen sie im Allgemeinen den Flüssen und Waldkanälen, die ihnen als Orientierungspunkte dienen.

In den entlegensten Ecken des Regenwaldes hat noch kein menschlicher Fuß einen Fuß gesetzt.
Und diese "Ecken" sind nicht so klein. Dreitausend Kilometer landeinwärts, von Guinea bis zu den Gipfeln von Rwenzori, erstrecken sich die tropischen Wälder Afrikas in einer ununterbrochenen Anordnung. Ihre durchschnittliche Breite beträgt etwa tausend Kilometer. Die Länge der Amazonaswälder ist sogar noch bedeutender - über dreitausend Kilometer von Ost nach West und zweitausend Kilometer von Nord nach Süd - sieben Millionen Quadratkilometer, zwei Drittel Europas! Was ist mit den Wäldern von Borneo, Sumatra und Neuguinea? Ungefähr 14 Millionen Quadratkilometer Land auf unserem Planeten sind von undurchdringlichen Walddschungeln besetzt, düster, stickig, feucht, in deren grüner Dämmerung "Wahnsinn und Schrecken lauern".
O Selva, Frau des Schweigens, "Mutter der Einsamkeit und Nebel"!
„Welches böse Schicksal hat mich in dein grünes Gefängnis gesperrt? Das Zelt deines Blattwerks ist wie ein riesiges Gewölbe für immer über meinem Kopf ... Lass mich gehen, oh Eelva, aus deinem krankheitsverursachenden Zwielicht, vergiftet vom Atem der Kreaturen, die in der Hoffnungslosigkeit deiner Größe quälen. Du wirkst wie ein riesiger Friedhof, auf dem du selbst in Verfall verwandelst und wiedergeboren wirst ...
Wo ist die Poesie abgeschiedener Haine, wo sind Schmetterlinge wie durchsichtige Blumen, magische Vögel, melodische Bäche? Die erbärmliche Phantasie von Dichtern, die nur häusliche Einsamkeit kennen.

Keine verliebten Nachtigallen, keine Versailler Parks, keine sentimentalen Panoramen! Hier ist das eintönige Keuchen von Kröten, wie das Keuchen von Menschen, die an Wassersucht leiden, die Wildnis von ungeselligen Hügeln, faulige Altwasser an Waldflüssen. Hier übersäen fleischfressende Pflanzen den Boden mit toten Bienen; ekelhafte Blumen schrumpfen in sinnlichem Zittern, und ihr süßer Geruch berauscht sie wie ein Zaubertrank; der Flaum der heimtückischen Schlingpflanze blendet Tiere, die Pringamosa verbrennt die Haut, die Kuruhu-Frucht sieht außen aus wie eine Regenbogenkugel, aber innen ist sie wie ätzende Asche; wilde Trauben verursachen Durchfall und Nüsse - Bitterkeit selbst ...
Selva, jungfräulich und blutrünstig-grausam, macht einen Menschen besessen von dem Gedanken an eine drohende Gefahr ... Die Sinne verwirren den Verstand: Das Auge berührt, der Rücken sieht, die Nase erkennt den Weg, die Beine rechnen und das Blut schreit laut : "Rennen Rennen!"
Ich kenne keine aussagekräftigere Beschreibung des deprimierenden Eindrucks, den ein Urwald auf einen Menschen macht! Der Autor dieser Passage, der Kolumbianer Jose Rivera, kannte die „blutrünstige, grausame Selva“ gut. Er war an der Arbeit der gemischten Grenzkommission zur Beilegung des Streits zwischen Kolumbien und Venezuela beteiligt, verbrachte viel Zeit im Urwald des Amazonas-Tieflandes und erlebte all seine Schrecken.

Der Kontrast zwischen dieser düsteren Beschreibung des Regenwaldes und der Freude vor seinen Schönheiten, die man oft auf den Seiten der Abenteuerliteratur antrifft, ist frappierend. Ehrlich gesagt sind wir eher an begeisterte Geschichten über die Natur der Tropen gewöhnt. Wenn wir uns einen Regenwald vorstellen, erinnern wir uns normalerweise an Bilder der fabelhaften Pracht der unberührten Natur: ein bizarres Geflecht aus Ranken, riesigen und leuchtenden Blumen, funkelnd wie Edelsteine, Schmetterlinge und Kolibris, bemalt wie Christbaumschmuck, Papageien und Eisvögel. Überall strahlende Sonne, wunderbare Farben, Animation und klangvolle Triller. Schönheit ist bezaubernd!
So ist es: In allem gibt es einen Abgrund an Schönheit, aber auf dieser Erde voller Leben sollte man weder liegen noch sitzen. Du kannst nur in Bewegung bleiben.

„Versuchen Sie“, schreibt der Afrikaforscher Stanley, „legen Sie Ihre Hand auf einen Baum oder strecken Sie sich auf den Boden, setzen Sie sich auf einen abgebrochenen Ast und Sie werden begreifen, welche Macht der Aktivität, welche energische Bosheit und welche zerstörerische Gier Sie umgeben. Öffnen Sie ein Notizbuch - sofort landen ein Dutzend Schmetterlinge auf der Seite, eine Biene wirbelt über Ihrer Hand, andere Bienen streben danach, Sie direkt ins Auge zu stechen, eine Wespe summt vor Ihrem Ohr, eine riesige Bremse huscht vor Ihrer Nase, und ein ganzer Schwarm Ameisen kriecht dir zu Füßen: Vorsicht! Die Vorhut ist bereits aufgestanden, sie klettert schnell hinauf, nur für den Fall, dass sie ihre scharfen Kiefer in deinen Hinterkopf rammen ... Oh, wehe, wehe!
Unter anderen „Problemen“ erwähnt dieser Forscher die Pharaonenlaus oder, in der Landessprache, den Jigger. Sie legt ihre Eier unter ihren großen Zehennagel. Seine Larven breiten sich im ganzen Körper aus und "verwandeln ihn in eine Ansammlung von eitrigem Schorf".
Ein kleiner Käfer geht auch unter die Haut und sticht, genau wie eine Nadel. Überall gibt es große und kleine Zecken und Landegel, die armen Reisenden das Blut aussaugen, und davon sei „schon wenig übrig“. Unzählige Wespen stechen so, dass sie einen Menschen in den Wahnsinn treiben, und wenn sie sich mit der ganzen Herde stürzen, dann in den Tod. Die Tigerschnecke fällt von den Zweigen und hinterlässt eine "giftige Spur ihrer Präsenz auf der Haut Ihres Körpers, sodass Sie sich vor Schmerzen winden und mit einer guten Obszönität schreien". Rote Ameisen, die nachts das Lager angreifen, lassen niemanden schlafen. Von den Bissen schwarzer Ameisen "erfährt man die Qualen der Hölle". Ameisen sind überall! Sie kriechen unter die Kleidung, fallen ins Essen. Schlucken Sie ein halbes Dutzend davon - und "die Schleimhäute des Magens werden geschwürig sein".
Legen Sie Ihr Ohr an den Stamm eines umgestürzten Baumes oder einen alten Baumstumpf. Hörst du das Rumpeln und Zwitschern im Inneren?
Sie sind beschäftigt, summen, fressen sich gegenseitig unzählige Insekten und natürlich Ameisen, Ameisen verschiedener Rassen und Größen. Die Ameisen, die in diesem „Reich des Grauens“ leben, verursachen nicht nur mit ihren Bissen unsägliches Leid. Auf dem Boden, der mit verwesenden Baumkörpern und Moosen übersät ist, zwischen den giftigen Dämpfen der Amazonas-Sümpfe, streifen Millionen von Horden von Etsitons umher, die lokal „Tambocha“ genannt werden. Als Zeichen der großen Gefahr ertönen die unheilvollen Schreie der Ameisenbären in der Wolkenstein, die alle Lebewesen vor dem Nahen des "Schwarzen Todes" warnen. Große und kleine Raubtiere, Insekten, Waldschweine, Reptilien, Menschen – sie alle fliehen panisch vor den marschierenden Kolonnen der Aetonen. Viele Forscher haben über diese gefräßigen Kreaturen geschrieben. Aber die beste Beschreibung gehört wieder José Rivera:
„Sein Schrei war schrecklicher als der Schrei, der den Beginn des Krieges ankündigte:
Ameisen! Ameisen!
Ameisen! Das bedeutete, dass die Menschen sofort aufhören sollten zu arbeiten, ihre Häuser verlassen, sich durch Feuer zurückziehen, irgendwo Schutz suchen sollten. Es war eine Invasion der blutrünstigen Tambocha-Ameisen. Sie verwüsten weite Räume und rücken mit einem Lärm vor, der an das Brüllen eines Feuers erinnert. Ähnlich flügellosen Wespen mit rotem Kopf und dünnem Körper erschrecken sie durch ihre Anzahl und ihre Gefräßigkeit. Eine dicke, stinkende Welle sickert in jedes Loch, in jede Ritze, in jede Mulde, ins Laub, in Nester und Bienenstöcke, verschlingt Tauben, Ratten, Reptilien, schlägt Menschen und Tiere in die Flucht ...
Nach ein paar Augenblicken war der Wald von einem dumpfen Geräusch erfüllt, wie das Rauschen von Wasser, das durch einen Damm bricht.
Oh mein Gott! Ameisen!
Dann erfasste ein Gedanke alle: gerettet zu werden. Sie zogen Blutegel den Ameisen vor und suchten Zuflucht in einem kleinen Tümpel, in das sie bis zum Hals eintauchten.
Sie sahen, wie die erste Lawine vorbeizog. Wie die weit verstreute Asche eines Feuers plumpsten Horden von Kakerlaken und Käfern in den Sumpf, und seine Ufer waren mit Spinnen und Schlangen bedeckt, und Menschen störten das verrottete Wasser und verscheuchten Insekten und Tiere. Die Blätter brodelten wie ein kochender Kessel. Das Gebrüll der Invasion ging über die Erde; die Bäume waren in eine schwarze Hülle gehüllt, eine bewegliche Hülle, die unbarmherzig höher und höher stieg, Blätter abbrach, Nester leerte, in Mulden kletterte.
Ein Fluss, in dem man nicht schwimmen kann
Auf den weichen Polstern aus smaragdgrünen Moosen, die den Boden bedecken, kann man sich in der „schrecklichen Selva“ ohne Vorsichtsmaßnahmen weder hinsetzen noch hinlegen. Es ist unmöglich, hier ohne großes Risiko zu schwimmen. Erschöpfende Hitze treibt die Bewohner der Wildnis in den Schatten der Flusskühle. Aber die Angst vor den Gefahren des großen Flusses lässt sie hastig den Rückzug antreten und ihren Durst kaum mit ein paar Schlucken stillen.
Zahlreiche Krokodile und Wasserboas sind noch nicht die gefährlichsten Kreaturen, die im Amazonas und seinen unzähligen Nebenflüssen leben.
Es gibt erstaunliche Fische, die wie riesige fette Würmer aussehen. Das sind Zitteraale. Sie verstecken sich am Grund stiller Nebengewässer und werden von einem Menschen oder einem Tier gestört und werfen Blitze in alle Richtungen – eine elektrische Entladung nach der anderen blitzt im Fluss auf. Die Spannung im Moment der Entladung des "elektrischen Fisches" kann 500 Volt erreichen! Eine Person, die einen elektrischen Riss erhalten hat, kommt nicht sofort zur Besinnung. Und es gab Fälle, in denen Menschen in einer flachen Furt ertranken und auf eine verärgerte Gruppe Zitteraale stießen.
Leben Sie im großen Amazonas und giftigen Stachelrochen - typische Meeresbewohner, wie es scheint. Außer im Amazonas findet man sie in keinen Flüssen mehr, sondern nur noch in den Meeren.
Der Araya-Stachelrochen, wie ihn die Brasilianer nennen, hat zwei gezackte, giftige Stacheln an seinem Schwanz. Es ist sehr schwierig, einen im Sand vergrabenen Stachelrochen zu bemerken. Nach einem Schlag mit Stilettos springt eine Person, angetrieben von unerträglichen Schmerzen, wie eine feurige Peitsche aus dem Wasser. Und dann fällt er in den Sand, blutet und verliert das Bewusstsein. Es wird gesagt, dass Wunden von vergifteten Araya-Stilettos größtenteils tödlich sind.
Aber nicht der Araya-Stachelrochen – das gefährlichste Flusstier des Amazonas. Und nicht die Haie, die hierher aus dem Ozean schwimmen und bis an die Spitze des großen Flusses gelangen.
Der wahre Albtraum dieser Orte sind zwei kleine Fische: Pirayah und Candiru. Wo sie in großer Zahl anzutreffen sind, wagt sich kein einziger Mensch bei unerträglichster Hitze auch nur knietief ins Wasser.
Piraia ist nicht größer als eine große Karausche, aber ihre Zähne sind scharf wie ein Rasiermesser. Ein Piraya kann sofort einen fingerdicken Stock beißen und reißt einen Finger ab, wenn eine Person ihn versehentlich in der Nähe des "roten" Piraya ins Wasser steckt.
Pirayas greifen in Herden an, reißen Fleischstücke aus dem Körper eines schwimmenden Tieres und nagen das Tier in wenigen Minuten bis auf die Knochen ab. Ein Wildschwein, das einem Jaguar entkommt, springt in den Fluss. Sie schafft es, nur ein Dutzend Meter zu schwimmen – dann tragen die Wellen ihr blutiges Skelett. Blutrünstige Fische, die Fleischreste von den Knochen reißen, stoßen mit ihren stumpfen Schnauzen dagegen, und das leblose Gerippe eines gerade noch kraftstrotzenden Tieres tanzt einen fürchterlichen Totentanz über dem Wasser.
Es kommt vor, dass ein starker Stier, der im Fluss von Pirayas angegriffen wird, es schafft, an Land zu springen: Er sieht aus wie ein gehäuteter Kadaver!
Ein weiterer gefährlicher Fisch im Amazonas ist der Candiru oder Carnero, der winzig ist und wie ein Wurm aussieht. Seine Länge beträgt sieben bis fünfzehn Zentimeter, seine Dicke nur wenige Millimeter. Candiru klettert im Handumdrehen in die natürlichen Öffnungen am Körper einer badenden Person und beißt von innen in ihre Wände. Es ist unmöglich, es ohne chirurgischen Eingriff herauszuziehen.
Elgot Lange, der zwölf abenteuerliche Monate in den Amazonaswäldern lebte, erzählt, dass es die Angewohnheit der Waldbewohner war, aus Angst vor dem Candiru nur in speziellen Becken zu baden. Ein Holzsteg ist tief über dem Wasser gebaut. In der Mitte ist ein Fenster durchgeschnitten. Durch sie schöpft der Badende mit einer Nussschale Wasser und übergießt sich nach eingehender Prüfung.
Nichts zu sagen - ein lustiges Leben!
Es ist gefährlich, tagsüber zu schlafen!
Viele Anfänger in der Wolkenstein haben teuer dafür bezahlt, hier mitten am Tag für ein oder zwei Stunden ein Nickerchen zu machen. Aus Angst vor Ameisen ließen sich Reisende in Hängematten nieder. Aber leider! Sie haben die grünen Fliegen "Varega" vergessen. Ein schlafender Mensch ist für sie ein Glücksfall: Varega-Fliegen legen ihre Eier in seine Nase und Ohren. Nach einigen Tagen schlüpfen Larven aus den Eiern und beginnen, eine lebende Person zu fressen. Sie entstellen das Gesicht, nagen tiefe Gänge unter die Haut in die Gesichtsmuskeln. Meistens fressen sie den Gaumen auf, und wenn es viele Larven gibt, fressen sie den größten Teil des Gesichts auf und die Person stirbt einen schmerzhaften Tod.
Der Schläfer wird vor ekelhaften Fliegen geschützt - er wird von Blutegeln angegriffen. Wasser und Land, sie leben hier überall - in jeder Pfütze, im Moos, unter Steinen, Laub, auf Büschen und Bäumen. Landegel kriechen überraschend schnell. Sie spüren die Beute und stürzen sich gierig auf vorbeikommende Menschen und Tiere, wobei sie sich um ihre Beine, ihren Hals und ihren Hinterkopf klammern. Sie kriechen in den Rachen und sogar in die Luftröhre zum Schlafenden. Nachdem er Blut gesaugt hat, schwillt der Blutegel an, verschließt die Luftröhre wie ein Korken und die Person erstickt.

Viele andere Schrecken erwarten den Menschen in der "grünen Hölle" der Tropen.
Ich habe nicht einmal ein Drittel der gefährlichen Tiere genannt, keine einzige tödliche Pflanze wurde erwähnt. Und ist das nicht genug!
Denken Sie auch an Raubtiere, giftige Kreaturen - Schlangen, Spinnen, Skorpione, Tausendfüßler, Tsetse-Fliegen, die ganze Regionen Afrikas verwüsten, südamerikanische Käfer - Überträger einer der Schlafkrankheit ähnlichen Krankheit, Vampire, Zecken ...
Hier verursacht sogar gewöhnlicher Regen oft ein schmerzhaftes Fieber bei einer Person. Arkady Fidler hat am eigenen Leib erfahren, dass es in den Wäldern Brasiliens gilt, Regen wie Feuer zu meiden. Es verursacht schnell "starke Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, Fieber und andere Beschwerden".
Stanley spricht über den schnellen Tod mehrerer seiner Träger durch einen kalten tropischen Regenguss.
Aber die schrecklichste Geißel der Tropen sind keine Raubfische und Ameisen, keine giftigen Reptilien, sondern unsichtbare Kreaturen: mikroskopisch kleine Bakterien und Bazillen, Erreger gefährlicher Krankheiten.

Es gibt Hunderte von ihnen, studiert, halb studiert und Fachleuten unbekannt. Malaria, Schlafkrankheit, ihre südamerikanische "Schwester" - Chagas-Krankheit, tropische Amöbenruhr, Gelbfieber, Himbeerpocken, Yaws, schwarze Pocken, Elephantiasis, Beriberi, schwarze Kalaazar-Krankheit, Ulcus Pendin, Dengue-Fieber, Bilharziose ...
Liest du alles!
Gegen viele von ihnen gibt es keine wirksamen Mittel. Die „heilbarste" Tropenkrankheit - Malaria verwüstet weite Teile der Erde, ganze Länder werden unbewohnt. In letzter Zeit erkranken allein in Indien jährlich etwa 100 Millionen Menschen an Malaria, mehr als eine Million sterben! In Teilen Afrikas tötet die Schlafkrankheit während einer Epidemie bis zu zwei Drittel der Bevölkerung. In den letzten Jahrzehnten sind mehr als eine Million Menschen daran gestorben.
Aus diesem Grund vermeiden Abenteurer - Reisende, Jäger, Sportler und sogar Sammler und Entdecker auf ihren Reisen in tropische Länder tödliche Wildnis, feuchte und düstere Wälder.
Ein seltener Entdecker wagte es, tief in die schreckliche Selva vorzudringen. Und wer wagte, er kam nicht immer zurück.
Nachdem sie mehrere Monate in irgendeinem „Toldo“ eines europäischen Siedlers oder in einem Indianerdorf am Flussufer verbracht und wissenschaftliches Material von den Häuten erschossener Tiere und Vögel und Insekten gesammelt haben, die im Licht gefangen wurden, verlassen Zoologen eilig die unwirtliche Region mit ihrer Konstante Gefahren und schwächenden Krankheiten, wo nichts zu machen ist, sich hinzulegen, sich nicht hinzusetzen, nicht im kühlen Schatten ein Nickerchen zu machen, nicht in der Hitze zu schwimmen, wo sogar der Regen Todesangst haben muss und wo es so ist man kann sich leicht verirren wie im ägyptischen Labyrinth. Nachdem Sie mehrere Kilometer tief in den Wald eingedrungen sind, riskieren Sie, nie wieder zurückzukommen. Für mehrere schmerzhafte Monate, die hier verbracht werden, wird der Wald - ein Tempel von sagenhafter Schönheit - zu einem "Tempel der Trauer", "Mutter der Nebel und Verzweiflung", "Frau des Schweigens". Schnell, raus hier!

Und die riesigen Bäume, deren Kraft und Strenge sogar die ersten Konquistadoren in Ehrfurcht versetzten, stehen wachsam Wache, gleichgültig gegenüber menschlichen Freuden und Ängsten, und bewachen die Ein- und Ausgänge zur Behausung noch unbekannter Geheimnisse. Dort, hinter der undurchdringlichen Mauer dieser stillen Wächter, ist die wilde Selva - das zitternde Herz der unberührten Natur.
"Neugeborene Arten"
"Glauben Sie nicht all den Fantasiegeschichten über den Dschungel, aber denken Sie daran, dass sich hier selbst die unglaublichsten Geschichten als wahr herausstellen können." Solche Ratschläge gibt K. Winton seinen Lesern in dem Buch „Whisper of the Jungle“. Er widmete mehr als zwanzig Jahre dem Studium der tropischen Wälder Südamerikas. Er kehrte in sein Heimatland, die USA, zurück und hielt eine Vortragsreihe unter einem sehr unerwarteten Titel: „Hospitable Jungle“. Er argumentierte, dass die Gefahren dieser Orte von den Autoren der Abenteuerliteratur stark übertrieben würden.
In dem Buch „Whisper of the Jungle“ versucht K. Vinton, den Mythos der „unmenschlichen Selva“ zu entlarven. Aber seine Argumente klingen nicht ganz überzeugend: K. Winton offenbart die Empfindungen skrupelloser Schriftsteller und beschreibt nur einige der gefährlichen Tiere des Amazonas. Aber auch in seiner wohlwollenden Interpretation sehen die Heldentaten von Vampiren, Piray, Candiru und anderen Raubtieren ziemlich gruselig aus.

Candiru ist kein Mythos. Candiru existieren, sagt K. Winton, und fügen ihren Opfern wirklich viel Qual zu. Aber diese blutrünstigen "Dämonen" können manchmal mit einer Tasse bitterem Jagua-Fruchtsaft aus dem Körper einer Person vertrieben werden, "wobei einem schrecklich übel wird".
Winton und seine Gefährten mussten in einigen Nebenflüssen des Amazonas bis zum Hals ins Wasser gehen, und die Pirahas rasten vorbei, ohne auf sie zu achten. Aber die Reisenden trafen einen Indianer, dessen Zeigefinger von einer Pirayah abgebissen worden war, als er sich im Fluss die Hände wusch.
Ein Moskitonetz schützt perfekt vor blutsaugenden Fledermäusen, aber die Vampire haben es dennoch geschafft, über Nacht viel Blut von einem Reisenden in Panama zu trinken. Der Mann war so schwach, dass er sich am nächsten Morgen kaum noch schleppen konnte.
K. Vinton beschrieb perfekt das Leben vieler Bewohner des Tropenwaldes. Aber er konnte seine Hauptthese nicht beweisen - über die Gastfreundschaft des Dschungels. Für den Leser mag es interessant sein zu erfahren, wie das Buch von K. Winton erschienen ist. Es gab einen zweiten Weltkrieg. Amerikanische Soldaten, die unter dem plausiblen Vorwand der "Verteidigung des amerikanischen Kontinents" in die Länder Mittel- und Südamerikas geschickt wurden, hatten Angst vor der Selva. Sie weigerten sich, in den Dschungel zu gehen. Die Armeeführung bat den Biologen C. Winton, eine Reihe von Vorträgen über die Unbegründetheit ihrer Befürchtungen zu lesen. Winton hat es geschafft. Aus den Vorträgen ist das Buch „Whisper of the Jungle“ entstanden. Sein Autor verfolgte ein ganz bestimmtes Ziel – den Tropenwald von seiner guten Seite zu zeigen.

Unser Buch hat einen anderen Zweck. Die Leser werden weiter sehen, dass einige der darin erzählten Geschichten einer Klärung bedürfen. Warum ist zum Beispiel noch nicht sicher geklärt, ob der afrikanische „Bär“ oder „Beuteltier“ tatsächlich existiert? Warum wird der vor über vierzig Jahren in den Wäldern des Kongo entdeckte Wassermungo nicht gefangen?
Die Antwort auf diese Fragen ist die Unwirtlichkeit des Dschungels!
Der Hauptgrund für die schlechte Erforschung des Tropenwaldes ist die Unzugänglichkeit seiner inneren Regionen für umfangreiche Forschung. Die Arena der wissenschaftlichen Forschung ist hier so groß und die Natur so vielfältig, dass kurzfristige Expeditionen einzelner Enthusiasten, die von Zeit zu Zeit hierher kommen, um zoologische Sammlungen zu sammeln, nicht ausreichen, um ihre innersten Geheimnisse zu befriedigen. Wir brauchen die gemeinsamen und freundschaftlichen Bemühungen von Hunderten von Spezialisten aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Berufen, wie in der Antarktis!
Nur eine solche Organisation der wissenschaftlichen Arbeit wird schnelle Ergebnisse liefern und dabei helfen, die spannenden Geheimnisse des "grünen Kontinents" zu lüften. Es gibt zweifellos noch viele weitere unbekannte Kreaturen, die in den Regenwäldern lauern.
Schließlich entdecken Zoologen jedes Jahr vor allem in den Tropen immer mehr neue Tiere. Experten beschreiben jedes Jahr durchschnittlich etwa zehntausend neue Arten, Unterarten und Varietäten. Im Grunde sind das natürlich kleine Tiere - Insekten (die Hälfte aller neuesten zoologischen Entdeckungen), Mollusken, Würmer, kleine tropische Fische, Singvögel, Nagetiere, Fledermäuse.
Es stimmt, einige Forscher ziehen, um es milde auszudrücken, voreilige Schlüsse und nehmen eine der Wissenschaft bereits bekannte Tierart als neue Art an, die nur geringfügige Unterschiede aufweist, so dass die Anzahl der tatsächlichen Entdeckungen viel geringer ist als die angegebene Zahl.
In den letzten 60 Jahren wurden in verschiedenen Ländern (hauptsächlich in tropischen Wäldern) große Tiere gefunden - 34 bisher unbekannte Arten und Unterarten von Tieren und Vögeln. Zwölf von ihnen gehören nicht nur zu neuen Arten, sondern auch zu neuen Gattungen, und ein seltsamer Vogel sogar zu einer neuen Familie; Diese Tiere sind daher mit sehr eigentümlichen Merkmalen und ziemlich scharfen Unterschieden zu den der Wissenschaft bereits bekannten Arten ausgestattet.
Zur besseren Überzeugungskraft werde ich diese 34 neu entdeckten Tierarten auflisten.
Affe
1. Berggorilla. 1903 in den Bergwäldern Zentralafrikas entdeckt. Der größte der Affen.
2. Zwerggorilla. 1913 vom amerikanischen Zoologen Elliot beschrieben. Es lebt in den Wäldern des rechten Ufers des Unterlaufs des Kongo.
3. Zwergschimpanse. 1929 vom Zoologen Schwartz beschrieben. 1957 identifizierten die deutschen Zoologen Tratz und Geck ihn als eine besondere Gattung von Menschenaffen. Lebt in den Wäldern des Kongo.
4. Somalischer Pavian. 1942 in Somalia eröffnet.
5. Weißbeiniger Kolob oder Seidenaffe von Fernando Po (einer Insel im Golf von Guinea vor der Küste Kameruns). 1942 beschrieben.
6. Afrikanischer Wald- oder Rundohrelefant. 1900 vom deutschen Zoologen Machi in den Wäldern Kameruns entdeckt.
7. Zwergelefant. 1906 vom deutschen Professor Noack beschrieben (derzeit als Unterart des Waldelefanten angesehen).
8. Sumpfelefant. Hergestellt in den Wäldern des Kongo in der Nähe des Sees Leopold II. 1914 vom belgischen Zoologen Professor Schuteden (eine Unterart des Waldelefanten) beschrieben.
Nashörner
9. Sudanesisches Breitmaulnashorn oder Baumwollnashorn. 1901 vom englischen Reisenden Gibbons in den Sümpfen des Südsudan entdeckt. Später in den Wäldern von Uele (nordöstlich des Kongo) entdeckt, gilt es als Unterart des südafrikanischen Breitmaulnashorns.
Andere Huftiere
10 Okapi "Waldgiraffe". Ein ungewöhnliches Tier, ähnlich den primitiven Giraffen, die einst in ganz Afrika und sogar in Westeuropa lebten. 1900 in den Wäldern von Ituri und anderen Gebieten im Osten des Kongo entdeckt.
11. Riesenwaldschwein - der größte Vertreter von Wildschweinen, kombiniert die Merkmale europäischer Wildschweine und afrikanischer Warzenschweine. 1904 in den Bergwäldern Kenias entdeckt.
12. Bergnyala, eine Antilope mit spiralförmigen Hörnern. - 1910 in den Bergen Äthiopiens entdeckt. Sein nächster Verwandter, der mosambikanische Nyala, lebt in Südafrika.
13. Goldener Takin oder "Bergbüffel", ein seltsames Huftier, das kürzlich mit den Moschusbullen Grönlands zusammengebracht wurde. 1911 in Tibet eröffnet. Sein Verwandter, der graue Takin, wurde 60 Jahre zuvor, im Jahr 1850, beschrieben.
14. "Grauer Stier" oder Kou-Beute. 1937 vom französischen Zoologen Urbain in den Wäldern Kambodschas eröffnet, einer der größten Wildbullen.
15. Schwarzer Tapir von Sumatra. 1936 vom holländischen Zoologen Kuiper beschrieben. Eine Unterart des indischen Tapirs.
16. Argentinisches Vicuña, eine viel größere Unterart des gemeinen Vicuña. 1944 vom deutschen Zoologen Krumbigel beschrieben.
17. Fischfressende Ginsterkatze oder „Wassermungo“. Von Jägern im Ituri-Regenwald (Nordosten des Kongo) entdeckt. 1919 vom amerikanischen Zoologen Allen beschrieben.
18. Königlicher oder gestreifter Gepard. Hergestellt 1927 in Südrhodesien vom Jäger Cooper, beschrieben vom englischen Zoologen Pocock. Der größte Vertreter der Geparden.
19. Hagenbecks Bergwolf. 1949 vom deutschen Zoologen Krumbigel anhand von Haut und Schädel beschrieben. Lebt laut Anwohnern in der Kordillere.
aquatische Säugetiere
20. Weißer Delphin. 1918 vom amerikanischen Zoologen Miller im Dongting-See in China entdeckt.
21. Tasmcetus oder neuseeländischer Wal (eine neue Art und Gattung aus der Familie der Schnabelwale). 1937 beschrieben.
22. Eine neue Seelöwenart. 1953 vom norwegischen Zoologen Sivertsen auf den Galapagosinseln entdeckt.
23. Kurzgesichtiger Delfin Ogneva. 1955 vom sowjetischen Zoologen M. Sleptsov im nordwestlichen Teil des Pazifischen Ozeans entdeckt. Einige Experten halten diese Art für nicht existent.
24. Eine neue Art von Gürtelzahnwalen. 1957 vor der Küste Japans hergestellt, 1958 von dem japanischen Zoologen Dr. Nishivaki beschrieben.
25. Eine neue Art von Krähe. Es wurde 1934 vom deutschen Ornithologen Stresemann in den Wäldern von Queensland (einem Bundesstaat im Nordosten Australiens) entdeckt.
26. Afrikanischer Pfau. Es wurde 1936 vom amerikanischen Ornithologen Chapin entdeckt, zuerst im Schrank des Museums des Kongo (in Belgien), dann in den Wäldern von Ituri und Sankuru (Ost-Kongo).
27. Stresemanns Zavatariornis, ein seltsamer Vogel, dessen Klassifizierung die Schaffung einer neuen Familie erforderte. 1938 vom Italiener Moltoni in Südabessinien entdeckt.
28. Gehörnter Gokko. 1939 in den Tropenwäldern Boliviens entdeckt.
29. Mayers Paradiesvogel. 1939 vom englischen Zoologen Stonor beschrieben.
30. Neue Eule. 1939 vom deutschen Zoologen Neumann auf der Insel Celebes entdeckt.
31. Laube der besonderen Art. 1940 in den Wäldern von Neuguinea entdeckt.
32. Neuer Trogon, ein Vogel, der einem Ziegenmelker ähnelt, aber größer und schöner ist. 1948 in Kolumbien eröffnet.
33. Sturmvogel, genannt "der Letzte". 1949 im Pazifik vom amerikanischen Ornithologen Murphy entdeckt.
Reptilien
34. Riesenwaran. 1912 auf der Insel Komodo (Indonesien) eröffnet.
Es ist bezeichnend, dass 13 der aufgeführten Tiere vor 1925 entdeckt wurden und 21 - von 1925 bis 1955. Das deutet darauf hin, dass die natürlichen „Verstecke“, die unbekannte Tiere verstecken, noch nicht knapp geworden sind.
Hier ist zum Beispiel die „nicht abnehmende Progression“ ornithologischer Funde über mehrere Nachkriegsjahre. Drei neue Vogelarten wurden 1945 entdeckt, sieben 1946, drei 1947, zwei 1948, vier 1949, fünf 1950 und fünf 1951.
Der größte Spezialist für Tiertaxonomie, der amerikanische Zoologe Ernst Mayer, glaubt, dass mehr als 100 der Wissenschaft völlig unbekannte Vogelarten auf der Erde leben. Die Zahl der unentdeckten Insekten ist ungleich größer – etwa zwei Millionen!
Entomologen haben offenbar noch viel zu tun.
In jeder Gruppe nicht sehr großer Tiere - Würmer, Schwämme, Krebstiere, Weichtiere - sind jedoch derzeit nur etwa 60-50 und sogar 40% aller auf der Erde vorkommenden Arten offen.
Es wird angenommen, dass die Anzahl unentdeckter Amphibien, Reptilien und Säugetiere viel geringer ist - nur etwa 10% der bekannten Artenzahl dieser Tiere. Aber 10% sind auch viel! Damit können wir in Zukunft mit der Entdeckung von weiteren 600 neuen Amphibien und Reptilien sowie 300 Säugetieren rechnen. Die überwiegende Mehrheit werden natürlich Frösche, Molche, Eidechsen, kleine Nagetiere, Fledermäuse und insektenfressende Tiere sein.
Gibt es Hoffnung, noch unbekannte Raubtiere wie Löwen und Leoparden auf der Erde zu entdecken? Oder neue Menschenaffen, Antilopen, Elefanten, Wale und andere Großtiere?
Antworten auf diese Fragen suchen wir in den folgenden Kapiteln des Buches.

"Cousins" aus dem Dschungel
Pongo der Elefantenjäger
Vor 2400 Jahren brachte der karthagische Seefahrer Gannon seltsame Neuigkeiten von einer Reise an die Küsten Westafrikas. Er berichtete von wilden, haarigen Männern und Frauen, die der Übersetzer "Gorillas" nannte. Reisende trafen sie auf den Höhen von Sierra Leone. Wilde "Männer" begannen, Steine auf die Karthager zu werfen. Die Soldaten erwischten mehrere haarige „Frauen“.
Es wird angenommen, dass die Tiere, die Gannon sah, überhaupt keine Gorillas waren, sondern Paviane. Doch seitdem ist das Wort „Gorilla“ nicht mehr über die Lippen der Europäer gegangen.
Es vergingen jedoch Jahrhunderte, aber niemand traf die „haarigen Waldmenschen“ in Afrika, niemand hörte etwas von ihnen. Und selbst mittelalterliche Geographen, die leicht an Menschen mit „Hundeköpfen“ und kopflosen Lemnien mit Augen auf der Brust glaubten, begannen an der wahren Existenz von Gorillas zu zweifeln. Nach und nach etablierte sich unter Naturforschern die Meinung, dass die legendären Gorillas nur Schimpansen seien, "übertrieben" durch Gerüchte. Und Schimpansen waren zu dieser Zeit in Europa bereits bekannt. (1641 wurde der erste lebende Schimpanse nach Holland gebracht. Er wurde vom Anatom Tulp ausführlich beschrieben.)
Ende des 16. Jahrhunderts wurde der englische Seefahrer Andrei Betel von den Portugiesen gefangen genommen. Achtzehn Jahre lang lebte er in Afrika, nicht weit von Angola. Betel beschrieb sein Leben im wilden Land in dem Aufsatz "Die erstaunlichen Abenteuer von Andrei Betel", der 1625 in einer Reisesammlung veröffentlicht wurde. Betel spricht über zwei riesige Affen - Engeko und Pongo. Engeko ist ein Schimpanse, aber Pongo ist definitiv ein Gorilla. Pongo sieht aus wie ein Mensch, aber er kann nicht einmal einen Scheit ins Feuer werfen. Dieses Monster ist ein echter Riese. Mit einer Keule bewaffnet tötet er Menschen und jagt ... Elefanten. Es ist unmöglich, einen lebenden Pongo zu fangen, und einen toten zu finden, ist auch nicht einfach, weil Pongos ihre Toten unter Laub begraben.
Bethels unglaubliche Geschichten überzeugten nur wenige Menschen. Nur wenige Naturforscher glaubten damals an die Existenz von Gorillas. Unter den „Gläubigen“ war der berühmte französische Wissenschaftler Buffon. Er gab zu, dass Bethels Geschichten eine echte Grundlage haben könnten. Aber die "Ungläubigen" hielten die haarigen, affenähnlichen Menschen für eine unmögliche Chimäre, wie diese lächerlichen Monster, die die Giebel der Kathedrale Notre Dame schmücken.
Aber 1847 veröffentlichte Dr. Thomas Savage, der ein Jahr lang am Fluss Gabon (der südlich von Kamerun in den Golf von Guinea mündet) lebte, seine wissenschaftlichen Arbeiten in Boston. Dies war die erste zuverlässige Beschreibung der Lebensweise und des Aussehens von Gorillas.
„Ein Gorilla“, schrieb Savage, „eineinhalb Meter groß. Ihr Körper ist mit dichtem schwarzem Haar bedeckt. Im Alter wird der Gorilla grau.
Diese Affen leben in Herden, und in jeder Herde gibt es mehr Weibchen als Männchen. Geschichten darüber, wie Gorillas Frauen entführen und dass sie gelegentlich Elefanten in die Flucht schlagen können, sind völlig absurd und haltlos. Dieselben Taten werden manchmal Schimpansen zugeschrieben, und das ist noch lächerlicher.
Gorillas, wie Schimpansen, errichten ihre Behausungen – wenn sie Behausungen genannt werden können – in Bäumen. Diese Behausungen bestehen aus Ästen, die zwischen dichtem Blattwerk an den Astgabeln befestigt sind. Affen befinden sich nur nachts in ihnen. Anders als Schimpansen laufen Gorillas niemals vor Menschen davon. Sie sind wild und gehen leicht zum Angriff über. Die Einheimischen vermeiden es, sie zu konfrontieren und kämpfen nur zur Selbstverteidigung.
Wenn sie angegriffen werden, stoßen die Männchen ein schreckliches Gebrüll aus, das sich weit durch das umliegende Dickicht ausbreitet. Beim Atmen öffnet der Gorilla sein Maul weit. Ihre Unterlippe hängt bis zum Kinn herunter. Behaarte Hautfalten verlaufen bis zu den Augenbrauen. All dies verleiht dem Gorilla einen Ausdruck außergewöhnlicher Wildheit. Junge Gorillas und Weibchen verschwinden, sobald sie den alarmierenden Schrei ihres Anführers hören. Und er stößt schreckliche Schreie aus und stürzt sich wütend auf den Feind. Ist sich der Jäger der Treffsicherheit des Schusses nicht ganz sicher, lässt er den Gorilla schließen und hindert ihn nicht daran, die Mündung des Gewehrs mit den Händen zu packen und ins Maul zu stecken, was diese Tiere normalerweise tun, und nur dann zieht den Abzug. Ein Fehlschuss kostet den Jäger ausnahmslos das Leben.
Das Überraschendste ist, dass diese sehr realitätsnahe Beschreibung der Gorillas von Savage nur aus den Worten der Anwohner zusammengestellt wurde. Er selbst sah zufällig keinen einzigen lebenden Gorilla.
Dr. Savage brachte zwar mehrere Gorillaschädel aus Afrika mit. Aus diesen Schädeln beschrieb er zusammen mit Professor Wilman 1847 den Gorilla als eine neue Affenart und nannte ihn den „Höhlenbewohner-Gorilla“ (Troglodytes gorilla). "Schwarzer Höhlenbewohner" (Troglodytes niger) wurde damals ein Schimpanse genannt. Aber vier Jahre später, im Jahr 1851, bewies der französische Wissenschaftler Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, dass sich der Gorilla viel mehr vom Schimpansen unterschied, als Savage und Wilman dachten. Er stellte den Gorilla in eine eigene zoologische Gattung und gab ihm den Namen Gorilla gorilla.
So wurde das struppige Waldungeheuer nach jahrhundertelangen Zweifeln und Streitigkeiten endlich von der Wissenschaft anerkannt.
Doch keiner der Zoologen hat noch lebende Gorillas gesehen. Und daher könnten sich Skeptiker mit einem gewissen Recht mit dem Gedanken trösten, dass vielleicht ein Fehler unterlaufen ist: Wo ist die Garantie, dass nicht alle untersuchten Schädel zu einem bereits ausgestorbenen Tier gehören?
Acht Jahre nach Savages Bericht konnte jedoch selbst der hartgesottenste Thomas-Ungläubige keine solche Aussage machen.
Erster Europäer, der einen Gorilla tötete
1855 sah der berühmte Reisende und Zoologe Paul du Chaillu endlich den mysteriösen Gorilla.
So beschreibt er dieses bedeutsame Ereignis.
„Unweit des Lagers sahen wir ein verlassenes Dorf. An den Stellen, wo früher die Hütten standen, wuchs etwas, das wie Zuckerrohr aussah. Ich begann gierig, die Stängel dieser Pflanze zu brechen und den Saft auszusaugen. Plötzlich fiel meinen Begleitern ein Detail auf, das uns alle sehr begeisterte. Um uns herum lagen entwurzelte Zuckerrohrhalme auf dem Boden. Jemand zog sie heraus und warf sie dann auf den Boden. Wie wir hat er ihnen den Saft ausgesaugt. Dies waren zweifellos die Fußabdrücke eines kürzlich besuchten Gorillas. Das Herz war voller Freude. Meine schwarzen Begleiter sahen sich schweigend an. Da war ein Flüstern: „Ngila“ (Gorilla).
Wir folgten der Spur, suchten auf dem Boden nach zerkauten Rohrstücken und stießen schließlich auf die Fußspuren des so leidenschaftlich gesuchten Tieres. Es war das erste Mal, dass ich den Fußabdruck eines solchen Fußes gesehen habe, und es fällt mir schwer zu sagen, was ich in diesen Momenten erlebt habe. So konnte ich jede Sekunde einem Monster gegenüberstehen, über dessen Stärke, Wildheit und List mir die Einheimischen so viel erzählten.
Dieses Tier ist den Leuten der Wissenschaft fast unbekannt. Kein Weißer hat ihn je gejagt. Mein Herz schlug so laut, dass ich befürchtete, sein Klopfen würde den Gorilla erreichen. Die Nerven spannten sich schmerzhaft an.
Anhand der Spuren stellten wir fest, dass hier vier oder fünf offenbar nicht sehr große Gorillas gewesen waren. Mal bewegten sie sich auf allen Vieren, mal setzten sie sich auf den Boden, um das mitgeführte Zuckerrohr zu kauen. Die Verfolgung wurde intensiver. Ich muss gestehen, dass ich noch nie in meinem Leben so besorgt war wie in diesem Moment.
Nachdem wir vom Hügel heruntergekommen waren, überquerten wir den Fluss entlang des Stammes eines umgestürzten Baumes und näherten uns mehreren Granitfelsen. Am Fuß der Klippe lag der halb verrottete Stamm eines riesigen Baumes. Nach einer Reihe von Anzeichen zu urteilen, haben kürzlich Gorillas auf diesem Stamm gesessen. Wir machten uns mit äußerster Vorsicht auf den Weg nach vorne. Plötzlich hörte ich einen seltsamen, halbmenschlichen Schrei, und danach stürmten vier junge Gorillas an uns vorbei in den Wald. Schüsse fielen. Wir jagten ihnen nach, aber sie kannten den Wald besser als wir. Wir liefen bis zum völligen Kraftverlust ohne Ergebnis: Geschickte Tiere bewegten sich schneller als wir. Wir stapften langsam zum Lager, wo verängstigte Frauen auf uns warteten.
Später hatte du Chail mehr Glück und erschoss mehrere Gorillas. Vielleicht stammt eine der dramatischsten Beschreibungen des Angriffs eines wütenden Gorillas aus seiner Feder.
„Plötzlich teilten sich die Büsche – und vor uns war ein riesiger männlicher Gorilla. Er ging auf allen Vieren durch das Dickicht, aber als er Menschen sah, richtete er sich zu seiner vollen Größe auf und begann uns herausfordernd anzusehen. Diesen Anblick werde ich nie vergessen. Er war ungefähr zwei Meter groß, sein Körper war riesig, seine Brust war kräftig, seine Arme waren groß und muskulös. Seine wild lodernden Augen verliehen seinem Gesichtsausdruck einen dämonischen Ausdruck, etwas, das man nur in einem Albtraum sehen konnte; So stand dieser Herr der afrikanischen Wälder vor uns. Er zeigte keine Angst. Er schlug sich mit mächtigen Fäusten auf die Brust und drückte damit seine Bereitschaft aus, sich dem Kampf anzuschließen. Seine Brust summte wie eine Trommel, und gleichzeitig brüllte er, Flammen strahlten buchstäblich aus seinen Augen, aber wir zogen uns nicht zurück und bereiteten uns auf die Verteidigung vor.

Auf dem Kopf des Affen erhob sich ein haariger Kamm; der Kamm blühte jetzt auf, dann sträubte er sich wieder; Als der Gorilla sein Maul zum Bellen öffnete, waren riesige Zähne sichtbar. Der Gorilla machte ein paar Schritte nach vorne, hielt inne, stieß erneut ein bedrohliches Gebrüll aus, rückte weiter vor und erstarrte schließlich sechs Meter von uns entfernt. Als sie erneut knurrte und sich vor Wut auf die Brust schlug, schossen wir. Der Gorilla fiel zu Boden und stieß ein Stöhnen aus, das sowohl menschlich als auch tierisch war."
Jetzt zweifelte niemand daran, dass in Afrika seltsame vierarmige Monster leben. Das Verbreitungsgebiet fällt mit der Zone des tropischen Regenwaldes zusammen. Ende des letzten Jahrhunderts wurde festgestellt, dass Gorillas im Westen des tropischen Afrikas leben, in Ländern an der Küste des Golfs von Guinea von Ostnigeria bis Kamerun und Gabun. Daher wurden diese Gorillas als Küstengorillas bezeichnet. Ganz im Westen des Kongo lebt eine eng verwandte Art, der sogenannte Rotkopfgorilla.
Alter Mann aus Kivu
1863 erhielt die London Geographical Society ein seltsames Telegramm: "Neal geht es gut." Das Telegramm überraschte nicht nur Telegraphen, es begeisterte die gesamte Wissenschaftswelt Großbritanniens. Mitglieder der London Geographical Society verstanden sofort, worum es in dem Telegramm ging. Vor drei Jahren gingen die englischen Reisenden John Speke und Augustus Grant auf der Suche nach der Quelle des Nils tief nach Afrika.
Und jetzt kommt ein Telegramm von Speke; "Neal geht es gut." Damit ist das uralte Rätsel gelöst. Speke und Grant dringen in das Märchenland der "Mondberge" ein, in denen Gerüchten zufolge der Weiße Nil geboren wird, und entdecken seinen Ursprung.
Im selben Jahr, 1863, erzählte Speke seine Abenteuer in einem zweibändigen Buch, The Discovery of the Sources of the Nile. Ein Jahr später starb er bei einem Jagdunfall in England.
Dem mutigen Forscher gelang es in seinem kurzen Leben (er starb im Alter von 37 Jahren) viele wichtige geografische Entdeckungen zu machen. Von seinen Reisen brachte er für Zoologen interessante Informationen mit. Aber zunächst wurde ihnen nicht die gebührende Bedeutung beigemessen. Schließlich berichtete Speke weder mehr noch weniger, sondern von einem schrecklichen Zottelmonster, das in den Bergwäldern Ruandas lebt. Dieses Monster „umarmt Frauen so fest, dass sie sterben“. Die Neger nannten ihn „ngila“ und sagten, dass das Tier in seinem Aussehen wie ein Mensch aussah, aber so lange Arme hatte, dass es einen Elefanten über den Bauch packen konnte. Wer könnte es glauben? Außerdem lebten weit im Westen Gorillas – die einzigen Kreaturen, die als fantastische „ngila“ klassifiziert werden konnten.
Es war bekannt, dass ihr Verbreitungsgebiet nach Osten nicht über die westlichsten Regionen des Kongo hinausreichte. Daher wurde Spekes Botschaft von Zoologen ignoriert. Und vergebens!
1901 betrachtete der deutsche Säugetierspezialist Machi mit Erstaunen die gigantische Affenhaut, die Kapitän Beringe vom Ufer des Kivu-Sees (nördlich von Tanganjika) mitbrachte. Es war ein Ngila, ein Berggorilla. Machi beschrieb es 1903 und benannte es zu Ehren von Captain Bering - Gorilla beringei.
Der Berggorilla ist noch mächtiger als seine Cousins aus den Wäldern des Golfs von Guinea, die Küstengorillas. Das Wachstum großer Männchen erreicht zwei Meter (und in Ausnahmefällen sogar 2 Meter 30 Zentimeter) und das Gewicht beträgt 200-350 Kilogramm. Der Brustumfang eines alten männlichen Berggorillas beträgt 1 Meter 70 Zentimeter, der Umfang des Bizeps beträgt 65 Zentimeter und die Armspannweite erreicht 2,7 Meter!
Das reicht fast aus, um einen kleinen Elefanten quer über den Oberkörper zu packen.
Touristen, Jäger, Tierjäger, die nach dem Ersten Weltkrieg Zentralafrika überschwemmten, träumten davon, nicht nur Antilopenhörner, sondern auch die Kopfhaut des „alten Mannes aus Kivu“ zu bekommen. „Der Berggorilla“, schrieb die „große Vogelscheuche“ Ackley, „ist zusammen mit Elefanten und Löwen zu einem „modischen Wild“ geworden. Das Schlagen der Gorillas muss sofort aufhören.“

Nur wenige Menschen haben das Leben dieser Affen in freier Wildbahn studiert. Selbst tote Gorillas fallen selten in die Hände von Wissenschaftlern. Inzwischen nimmt die Zahl der Gorillas rapide ab. Im März 1922 wurde schließlich das Berggorilla-Reservat eingerichtet. Mehrere tausend dieser vierarmigen Riesen leben heute in den Wäldern an den Hängen der Berge von Mykeno, Carisimba und Visoke (Kivu-Region).
Zwerggorilla
Es stellt sich heraus, dass es Zwerggorillas gibt. Aber über sie ist fast nichts bekannt.
Die Häute von Zwerggorillas landen gelegentlich aus den Sammlungen von Jägern in Museen, aber keiner der Zoologen hat die Tiere jemals selbst gesehen. Zwerggorillas wurden im "Dschungel" ... der Naturkundemuseen entdeckt. Der weltgrößte Affenspezialist, der amerikanische Zoologe Daniel Elliot, hat die Museumssammlungen von Menschenaffen studiert. Unter ihnen fand er mehrere seltsame Skelette und Häute. Ohne Zweifel gehörten sie zu erwachsenen Gorillas, aber von sehr kleiner Statur: Die Länge des männlichen Zwergs vom Scheitel bis zu den Fersen beträgt 1 Meter 40 Zentimeter (die durchschnittliche Größe eines Schimpansen). Die Fellfarbe ist dunkelgrau mit einem rötlich-braunen Farbton an Kopf und Schultern.
Laut den Etiketten auf diesen interessanten Funden wurde festgestellt, dass Zwerggorillas in Wäldern entlang der Ufer der Mündung des Flusses Ogooue (Gabun) leben. Mehr ist über sie nicht bekannt.
1913 sprach Elliot in einer dreibändigen Beschreibung von Affen über seine Entdeckung. Er nannte den Zwerggorilla Pseudogorilla mayema. Sein anderer wissenschaftlicher Name ist Gorilla (Pseudogorilla) ellioti.
16 Jahre nach der Entdeckung von Elliot untersuchte der Deutsche Ernst Schwartz auch die im Museum des Kongo (in Belgien) gesammelten Affensammlungen. Unter den Exponaten, die laut Museumskatalogen zu verschiedenen Arten von Schimpansen gehörten, fand er viele sehr zerbrechliche und kleine Knochen.
Schwartz dachte, er hätte es mit einem Zwergschimpansen zu tun und nannte ihn 1929 Pan satyrus paniscus.
Später wurden mehrere dieser Affen lebendig nach Europa und Amerika gebracht, und andere Wissenschaftler lernten sie kennen. Die Struktur von Schädel, Skelett, Muskulatur und Fell des Zwergschimpansen wurde 1933 von Coolidge, 1941 von Rode und 1952 von Miller untersucht. Freshkop (1935), Huck (1939) und Urbain (1940) schrieben über sein Verhalten und seinen Lebensstil. Einige Wissenschaftler (Coolidge, Huck, Miller, Freshkop) schlugen vor, den Zwergschimpansen in eine eigene Art zu trennen. Andere dachten, es sei nur eine Unterart des gewöhnlichen Schimpansen.
Aber es stellte sich heraus, dass weder das eine noch das andere recht hatte. Ein trauriger Vorfall in einem deutschen Zoo veranlasste zwei Zoologen, Zwergschimpansen genauer unter die Lupe zu nehmen. Als Ergebnis kamen sie zu dem Schluss, dass diese unterdimensionierten Schimpansen überhaupt keine Schimpansen sind, sondern eine ganz besondere und für die Wissenschaft neue Gattung der Menschenaffen, so eigenständig wie beispielsweise die Gattung der Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und Gibbons.
Es lohnt sich, ausführlicher über diese Entdeckung zu sprechen.
Bonobo ist unser neuer Verwandter
In der deutschen Stadt Hellabrunner, unweit von München, starben während der Angriffe amerikanischer Flugzeuge im Jahr 1944 viele Menschenaffen im Zoo. Die armen Tiere starben nicht an Wunden und Quetschungen, sondern an ... Angst. Das höllische Grollen der Artillerie, explodierende Bomben und Erdrutsche versetzten sie in unbeschreibliches Entsetzen. In Panik stürmten sie um die Käfige herum und kündigten den menschenleeren Park mit herzzerreißenden Schreien an.
Zoowissenschaftler, die am nächsten Morgen ihre Verluste zählten, stellten fest, dass sich alle toten Affen durch einen zerbrechlichen Körperbau auszeichnen und, wie sie damals glaubten, zu einer Zwergschimpansenart gehören. Im Leben waren sie scheue Wesen, sie mieden die großen Affen.
Wissenschaftler waren erstaunt, dass nur Zwergschimpansen an dem nervösen Schock starben, den sie während des Bombenangriffs erlebten. Warum nahmen ihre größeren Brüder die gleichen Ereignisse ziemlich gelassen hin? Schließlich starb kein einziger großer Schimpanse während des Bombenangriffs.
Offenbar ist dies kein Zufall. Wissenschaftler begannen, die Affen, die bisher fälschlicherweise als Zwergschimpansen galten, genauer unter die Lupe zu nehmen. Achten Sie auf die Schreie dieser Affen. Der Tierpfleger versicherte den Wissenschaftlern, dass sich kleine und große Schimpansen nicht verstehen, sie „sprechen“ seiner Meinung nach verschiedene Sprachen.
Kleine Schimpansen sind sehr mobil, freundlich und gesellig. Sie "chatten" ständig miteinander. In ihren Schreien sind die Vokale „a“ und „e“ zu hören. Affen begleiten ihre „Rede“ mit lebhaften Gesten.
Große Schimpansen sind düster und ungesellig. Ihre Stimme ist taub, und in ihren Schreien sind andere Vokale zu hören: „o“ und „u“. Manchmal, besonders wenn sie wütend sind, kreischen große Schimpansen. Sie stürzen sich aufeinander, beißen, kratzen. Kampfaffen versuchen mit ihren starken Armen, den Feind näher heranzuziehen und ihn mit ihren Zähnen zu packen.
Kleine Schimpansen werden selten wütend, streiten und kämpfen selten miteinander. Und im Kampf beißen sie nie, sondern belohnen sich nur mit Handschellen, „Box“. Affen haben schwache Fäuste, also schlagen sie lieber mit den Fersen zu.
Und vor einigen Jahren, im Jahr 1954, veröffentlichten die deutschen Wissenschaftler Eduard Tratz und Heinz Geck eine interessante Arbeit. Aufgrund ihrer Beobachtungen und Studien anderer Zoologen und Anatomen kamen sie zu dem Schluss, dass es sich bei den beim Hellarunner-Bombardement umgekommenen Affen nicht um eine Zwergschimpansenart, sondern um eine ganz besondere Art und Gattung von Menschenaffen (Bonobo paniscus) handelt. , sie unterscheiden sich so stark von allen anderen Affen und ihrer Psyche, ihrem Verhalten und ihrer Anatomie. Wissenschaftler haben der neuen Gattung den Namen „Bonobo“ gegeben – wie die Einheimischen diese Affen in ihrer Heimat im Kongo nennen. Kongolesen unterscheiden Bonobos von Schimpansen und anderen lokalen Vertretern der Affenrasse.
Die Familie unserer nächsten Verwandten im Tierreich – der Menschenaffen – ist also um ein weiteres neues Mitglied aufgestockt worden. Bisher gab es drei echte Menschenaffen – den Gorilla, den Schimpansen und den Orang-Utan. Jetzt sind es vier davon.
Die Leute fragen oft: Welcher der Affen ist dem Menschen am nächsten? Es ist schwierig, auf diese Frage eine eindeutige Antwort zu geben. Nach einigen Zeichen - ein Schimpanse, nach anderen - ein Gorilla, nach anderen - sogar ein Orang-Utan. Aber das Erstaunliche ist, dass die neu entdeckten Bonobos in vielerlei Hinsicht, insbesondere in der Schädelstruktur, dem Menschen näher zu sein scheinen als alle anderen Affen!
Die Bonobos haben einen abgerundeten, geräumigen Schädel, ohne die hochentwickelten Augenbrauenkämme und Kämme, die den Kopf eines Gorillas und Schimpansen entstellen. Bei allen anderen Affen ragt die Schnauze stark nach vorne, während die Stirn leicht konvex ist und nach hinten steil abfällt, als wäre sie von vorne nach hinten geschnitten. Bei Bonobos ist die Stirn stärker entwickelt, ihre Wölbungen beginnen unmittelbar hinter den Augenbrauenbögen und die Schnauze ragt leicht nach vorne. Der Hinterkopf des Bonobos ist ebenfalls abgerundet und leicht konvex.
Auch bei Bonobos sind Zoologen solche „menschlichen“ Merkmale aufgefallen: kleine Ohren, schmale Schultern, ein schlanker Körper und kein breitbeiniger, sondern ein schmaler gepflegter Fuß. Bei Bonobos, dem vielleicht einzigen Vertreter im Tierreich, sind die Lippen nicht schwarz, sondern rötlich, fast wie beim Menschen.
Und noch ein tolles Feature. Menschenaffen bewegen sich auf gebeugten Beinen auf dem Boden, während sie sich auf ihre Hände stützen. Beim Gehen verlassen sich Bonobos ebenfalls auf ihre Hände, aber wie ein Mensch strecken sie ihre Beine an den Knien vollständig durch.
Wo leben unsere neuen Verwandten? Woher kommen sie? Bonobos leben, soweit heute bekannt, in den westlichen Regionen des Kongobeckens in dichten Urwäldern. Nur wenige große Tiere haben es geschafft, sich an das Leben in der düsteren und feuchten Wildnis im Inneren des Regenwaldes anzupassen. Daher haben Bonobos nur wenige gefährliche Feinde. Auch Schimpansenaffen sind Waldbewohner, halten sich aber dennoch lieber näher am Waldrand auf.

Zwei weitere neue Affen
1942 fing der deutsche Fallensteller Rue in Somalia einen Affen, dessen Namen er in keinem der Handbücher finden konnte. Der deutsche Zoologe Ludwig Zhukovsky erklärte Rue, dass das von ihm gefangene Tier der Wissenschaft noch unbekannt sei. Dies ist ein Pavian, aber von besonderer Art. L. Zhukovsky gab ihm den Namen Papio ruhei, was - Rue der Pavian ist.
Im selben Jahr untersuchte ein anderer deutscher Zoologe - Dr. Ingo Krumbigel - die Sammlungen von Säugetieren, die in den Wäldern der Insel Fernando Po (im Golf von Guinea, nicht weit von Kamerun) gesammelt wurden. Die Insel ist klein: Ihre Fläche beträgt 2100 Quadratkilometer. Aber es ist ziemlich dicht besiedelt: Mehr als 20.000 Menschen leben hier.
In den Wäldern der Insel leben eine Vielzahl von Tieren. Bereits 1838 stellte der englische Naturforscher Waterhouse eine detaillierte Liste aller vierbeinigen und gefiederten Bewohner von Fernando Po zusammen.
Aber weder Waterhouse noch andere Forscher, die nach ihm die Insel besuchten, bemerkten das vielleicht auffälligste Tier hier!
Krumbigel, der die Sammlungen von Fernando Po durchsuchte, entdeckte darin eine seltsame schwarz-weiße Haut eines unbekannten Affen; Waterhouse hat sie nie erwähnt. Und der Affe ist sehr auffällig bemalt - wie ein Meilenstein! Ihr Körper ist schwarz und ihre Arme, Beine und ihr Kamm auf ihrem Kopf sind weiß.
Kann es sein, fragt sich Krumbiegel, dass es die schwarz-weiße Affenart zu Waterhouses Zeiten noch gar nicht gab? Es entwickelte sich später, nach Waterhouses Reise nach Fernando Po, indem es sich von einigen einheimischen Affenarten „abknospte“, zum Beispiel von schwarzen Kolobs.
Dies ist jedoch unwahrscheinlich.
Krumbigel nannte den Affen, den er entdeckte, Colobus metternichi - Metternichs Colob.
Kolob oder Seidenaffen hat die Natur mit vielen einzigartigen Eigenschaften ausgestattet.
Sie ernähren sich ausschließlich von pflanzlicher Nahrung, hauptsächlich von Baumblättern. Ein riesiger Magen, wie der einer Kuh, ist in drei Abschnitte unterteilt. In den komplexen Labyrinthen des Magens werden holzige Blätter gemahlen und verdaut. Dieser nährstoffarme Kolob kann unglaublich viel fressen - 2,5 Kilogramm in einer Mahlzeit. Aber sie selbst wiegt normalerweise ungefähr 7 Kilogramm! Nachdem es satt gegessen hat, hängt das Tier an einem Ast und erstarrt in einem schläfrigen Schlummer, während es langsam sein Mittagessen verdaut. Bei Bedarf bewegen sich die Kolobs jedoch sehr schnell. Sie leben im obersten „Stockwerk“ des Regenwaldes. Um nach unten zu gehen, springen Kolobs von den Wipfeln riesiger Bäume direkt zu den unteren Ästen und fliegen eine Entfernung von mehreren zehn Metern.
Der Körper einiger Seidenaffen ist an den Seiten (von den Vorder- bis zu den Hinterbeinen) von einem dichten Saum aus langem weißem Haar umgeben. Am Ende des Schwanzes bildet das Haar einen prächtigen Fächer.
Fransen und Fächer sind keine Verzierungen, sondern wunderbare Anpassungen für den Gleitflug. Wenn ein Affe von der Spitze eines Baumes springt, schwellen lange Haare wie ein Fallschirm an und stützen ihn im Flug.
Kolobs sind die einzigen Affen, deren schöne Felle von Pelzhändlern gejagt werden.
Aber sie zu bekommen ist nicht einfach. Kolobs leben in Urwäldern auf den Wipfeln riesiger Bäume. Einige Arten von Seidenaffen sind der Wissenschaft nur von einigen Häuten bekannt, die Reisende von lokalen Jägern gekauft haben.
Seit wann werden Yetis gefangen?
Vor 62 Jahren, im Jahr 1899, beschrieb Weddell, einer der ersten Europäer, der Tibet betrat, in seinem Buch „In the Himalayas“ seltsame, menschenähnliche Fußspuren, denen er in den hohen Schneefeldern am Donkyala-Pass begegnete. Seitdem hat fast jede Expedition in den Himalaya Berichte über behaarte Affenmenschen gebracht, die hoch oben in den Bergen leben. Sherpas – nepalesische Hochländer – nennen diese fantastischen Tiere Yeti.
Zuerst wollte niemand glauben, dass humanoide Kreaturen im kargen Schnee des höchsten Dornenrückens der Welt leben könnten. Aber es scheint, dass sich immer überzeugendere Fakten ansammeln. Mehr als einmal sahen und fotografierten sie Fußabdrücke des Yetis, als hätten sie ihren Schrei gehört. Vielleicht sind das große aufrecht stehende Menschenaffen, so etwas wie "Schneegorillas"?
Menschen, die nicht an die Existenz von Bigfoot glauben, greifen in der Polemik mit seinen Anhängern normalerweise auf das folgende Argument zurück:
Wenn Bigfoot existiert, sagen sie, warum können sie ihn nicht immer noch fangen. Fangen, fangen - und kein Ergebnis.
Aber Tatsache ist, dass bis vor kurzem niemand versucht hat, den mysteriösen Yeti zu fangen, und das aus einem sehr einfachen Grund - niemand hat an ihn geglaubt!
Obwohl Zoologen vor mehr als 60 Jahren vom Yeti hörten, wurde die erste Expedition zu seiner Suche erst 1954 organisiert.
Im Frühjahr 1957 begann die amerikanische Expedition von Tom Slick in Nepal zu arbeiten. 1958 schloss sich eine schottische Expedition und 1959 eine weitere amerikanische Jagdgesellschaft an. Immer neue Expeditionen stürmen die Höhen des Himalaya und vielleicht wird der schwer fassbare Yeti gefangen. Natürlich, sofern vorhanden. Und genau das bezweifeln viele Zoologen sehr. Die Angelegenheit wurde durch die Tatsache verkompliziert, dass bestimmte Kreise in den Vereinigten Staaten sich beeilten, ein interessantes wissenschaftliches Problem für sehr unziemliche Zwecke auszunutzen. Wie einige indische Zeitungen berichteten, sind nicht alle amerikanischen Expeditionen im Himalaya an der Suche nach Bigfoot beteiligt. Dies ist nur ein von ihnen benutzter Vorwand, um in die Grenzregionen Nepals mit der Volksrepublik China einzudringen. Es ist in der Tat seltsam, dass es keine öffentlich zugänglichen Veröffentlichungen über die Arbeit einiger "wissenschaftlicher" Expeditionen gibt, die Nepal in den letzten Jahren besucht haben. Wo und wie sie ihre Arbeit verrichteten, ist im Dunkeln.
Der Leser wird sich erinnern, dass amerikanische „Entdecker“ vor einigen Jahren einen noch lächerlicheren Vorwand zur Grenzaufklärung benutzten: Sie suchten an den Hängen des Ararat nach der Arche Noah!
Das alles ist sehr unangenehm. Es ist jetzt nicht einfach, das Problem des Yeti - was ist wahr, was ist falsch - in einem Wirrwarr widersprüchlicher Mythen, Fakten und politischer Intrigen zu verstehen.
Gibt es Menschenaffen in Amerika?
Leser, die sich mit Zoologie ein wenig auskennen, werden sagen - warum diese Frage? Schließlich steht seit langem fest, dass es in Amerika keine Menschenaffen gibt und nie gab: In keinem der amerikanischen Länder wurden trotz sorgfältiger Suche fossile Überreste von Menschenaffen (also Menschenaffen) gefunden.
Dennoch behaupten einige Wissenschaftler, dass in Südamerika, in den Urwäldern des Amazonas und des Orinoco, Menschenaffen leben. Sie sagen sogar, dass ein solcher Affe einmal in die Hände von Forschern gefallen ist. So war es.
1917 tauchten der Schweizer Geologe Francis de Loy und eine Gruppe von Kameraden in die riesigen tropischen Wälder der Sierra Perilla-Bergkette (entlang der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela) ein.
Drei Jahre voller Abenteuer verbrachten Reisende in der Wildnis. Schließlich gingen sie erschöpft von den Strapazen an den Fluss Tarra (ein Nebenfluss des Catatumbo, der von Südwesten in den Golf von Maracaibo mündet). Hier, am Ufer des Flusses, begegneten sie seltsamen Tieren. Eines Tages hörten wir Lärm und Schreie. Aus den Zelten gesprungen; Zwei große, bösartige Affen näherten sich ihnen, winkten mit den Armen und stießen einen „Kriegsschrei“ aus. Sie gingen auf zwei Beinen, waren sehr wütend, brachen Äste und warfen sie auf Menschen, in der Hoffnung, die ungebetenen Außerirdischen aus ihrem Besitz zu vertreiben.
Die Reisenden wollten das aggressivste Männchen erschießen. Aber im entscheidenden Moment versteckte er sich hinter der Frau, und sie bekam alle Kugeln.
Der getötete Affe wurde auf eine Kiste gelegt, mit einem Stock am Kinn gestützt, um ihn in sitzender Position zu halten, und fotografiert.
De Lua behauptet, dass dieser erstaunliche Affe keinen Schwanz hatte. In ihrem Mund zählte er angeblich nicht 36, wie alle amerikanischen Affen, sondern nur 32 Zähne, wie Menschenaffen.
Der Affe wurde gemessen: Seine Länge betrug 1 Meter 57 Zentimeter.
Sie entfernten die Haut von ihr, sezierten den Schädel und den Unterkiefer. Aber leider! Im heißen Klima der Tropen verschlechterte sich die Haut schnell. Verloren irgendwo in der Wildnis des Waldes und im Kiefer eines Affen. Der Schädel blieb am längsten erhalten und wäre vielleicht nach Europa gebracht worden, wenn er nicht zum Koch der Expedition gekommen wäre. Der Koch war ein großartiges Original: Er entschied sich, den Schädel des einzigartigsten Affen als ... Salzstreuer zu verwenden. Zweifellos ist dies nicht der beste Weg, um zoologische Sammlungen zu erhalten. Unter dem Einfluss von Feuchtigkeit und Salz zerfiel der Schädel an den Nähten, und unglückliche Sammler entschieden sich, ihn wegzuwerfen.
Schlechte Beispiele sind ansteckend
Am schlimmsten fanden Montandon und de Lois Anhänger, die auf grobe Fälschungen zurückgriffen, um dem Mythos des amerikanischen Pithecanthropus neues Leben einzuhauchen.
1951 veröffentlichte Courteville, ein Schweizer Entdecker Südamerikas, ein Buch in Frankreich. Darin erzählt er von seinen Begegnungen mit riesigen schwanzlosen Affen in den Wäldern derselben Gegend, in der de Loy umherwanderte, und zeigt sogar ein Foto einer seltsamen Kreatur, die er "Pithecanthropus" nennt. Dieser "Pithecanthropus", schreibt Dr. Euvelmans, "ist eine schamlose Fälschung."
Ein Foto des auf einer Kiste sitzenden Lua-Affen wurde aufgenommen, zerschnitten und in einer anderen Position vor der Kulisse eines Urwaldes wieder zusammengesetzt, aber so, dass nun deutlich sichtbar war, dass das Tier keinen Schwanz hatte.
Die Zeichnung des „Pithecanthropus“ von Courteville auf Packpapier ist nicht mehr glaubwürdig. Laut Euvelmans sieht die von Courteville gezeichnete Kreatur eher wie ein junger Gorilla aus als wie ein Lua-Affe, dessen kombiniertes Foto auf den folgenden Seiten platziert ist. Es gibt viele biologische Absurditäten in der Beschreibung des Tieres, dem Courteville angeblich begegnet ist.
Kurupira, Maribunda, Pelobo - wer sind sie?
Falschmeldungen und Fälschungen skrupelloser Forscher haben dem Prestige des Lua-Affen großen Schaden zugefügt. Inzwischen ist die Fotografie ein unbestreitbarer Beweis für ihre reale Existenz. Auf dem Foto sehen wir einen sehr großen Affen, ähnlich einem Mantel, aber den Zoologen unbekannt.
Gerüchte über solche Affen sind in den Wäldern des Amazonas weit verbreitet. Die ersten Entdecker Südamerikas, Alexander Humboldt und Henry Bates, berichteten von den mit Wolle bedeckten Wald-„Menschen“, deren Bräuche sehr an die Gewohnheiten großer Affen erinnern.
Bates spricht zum Beispiel über das mysteriöse Waldwesen Curupira, das große Angst vor den brasilianischen Indianern hat. „Manchmal wird er als etwas wie ein Orang-Utan dargestellt, der mit langem, struppigem Haar bedeckt ist und auf Bäumen lebt. An anderen Stellen heißt es, er habe unten gespaltene Beine und ein knallrotes Gesicht. Er hat eine Frau und Kinder. Manchmal geht er hinaus auf die Plantagen, um Maniok zu stehlen."
Bates sagt, dass der Curupira als Kobold verehrt wird. Spirituosen stehlen jedoch keinen Maniok!
Kürzlich wurden Goldgräber, die in die endlosen Wälder vordrangen, durch die der Fluss Araguaia kaum seinen Weg findet, von einem schrecklichen Gebrüll erschreckt, das in den Tiefen der wilden Selva zu hören war. Am nächsten Morgen fanden sie ihre Pferde tot vor: Jedem war die Zunge herausgerissen. Auf dem nassen Sand in der Nähe des Flusses bemerkten verängstigte Menschen eine Spur riesiger „menschlicher“ Beine mit einer Länge von 21 Zoll (52,5 Zentimeter).
Über diesen Fall berichtet der englische Naturforscher Frank Lane. Die Geschichte ähnelt jedoch den Handlungen fantastischer Geschichten.
Doch was wissen wir über das Leben in den gigantischen, völlig unerforschten Wäldern des geheimnisvollen Mato Grosso, dem westlichen Bundesstaat Brasiliens?
Die östliche Grenze von Mato Grosso verläuft entlang des Flusses Araguaia. Vielleicht leben dort ein paar unbekannte Affen, so groß und stark wie Gorillas. Seit langem ist von amerikanischen „Gorillas“ die Rede. Missionare aus dem Amazonas berichteten über sie, noch bevor Savage afrikanische Gorillas beschrieb.
Auf der Halbinsel Yucatan (in Mexiko) haben Archäologen seltsame Steinstatuen gefunden, die ... Gorillas sehr ähnlich sind. Kürzlich wurden unter den Felsskulpturen Südamerikas Figuren gefunden, die sogar Elefanten, Löwen und anderen afrikanischen Tieren ähneln. Dies beweist jedoch noch nicht, dass die Tiere, die lokalen Bildhauern als Modelle dienten, wirklich in den Wäldern Amerikas leben (oder in jüngerer Zeit gelebt haben).
Überraschende Funde zeugen vielmehr von kulturellen Bindungen zwischen den Völkern Amerikas und Afrikas, die lange vor der Entdeckung der Neuen Welt durch die Europäer bestanden.
Und doch reißen die Gerüchte über angeblich in der Wildnis Südamerikas lebende Menschenaffen bis heute nicht ab. Bernard Euvelmans sammelte viele Berichte über verschiedene Pelobo, Mapinguari, Pedegarrafa, Maribunda und andere seltsame "humanoide" Kreaturen, die nach südamerikanischen Legenden in den Regenwäldern von Brasilien, Venezuela, Kolumbien und Bolivien leben.
Von allen Berichten haben die Geschichten von de Vavrin, dem neuesten Entdecker Südamerikas, den größten wissenschaftlichen Wert. In seinem 1951 in Paris erschienenen Buch Wilde Tiere des Amazonas schreibt er:
„Ich habe mehr als einmal von der Existenz von Menschenaffen in den riesigen Wäldern im Norden von Mato Grosso an der Wasserscheide zwischen dem Amazonasbecken und dem Becken von Paraguay gehört. Ich habe sie selbst nicht gesehen. Aber überall in den heimischen Wäldern hört man viele Geschichten über sie. Noch hartnäckigere Gerüchte gibt es im Orinoco-Becken.
Diese Affen werden Maribunda genannt. Ihre Höhe beträgt etwa 1 Meter 50 Zentimeter. Ein Anwohner aus dem Oberlauf des Guaviare erzählte mir, dass er in seinem Haus ein Maribunda-Junges aufgezogen hat. Es war ein sehr freundliches und lustiges Tier. Aber als er aufwuchs, musste er getötet werden, weil er mit seinen Streichen großen Schaden anrichtete.
Der Schrei der Maribunda erinnert sehr an eine menschliche Stimme. Als ich durch das Dickicht des Waldes wanderte, hielt ich es selbst mehr als einmal für den Ruf der Indianer.
Einmal, im Oberlauf des Orinoco, säte die Maribunda Panik in de Wavrens Lager. Die Träger verwechselten ihre Schreie mit dem Schlachtruf der kriegerischen Guaharibo-Indianer.
Vielleicht sind die Maribunda Lua-Affen?
Für eine solche Behauptung gibt es keine hinreichenden Gründe. Der „Fall“ des mysteriösen Affen, der auf einer Kerosinkiste fotografiert wurde, ist noch nicht endgültig gelöst. Nur eines ist klar: Das ist kein Menschenaffe.
In den Tiefen der Wolkenstein warten Forscher offenbar noch immer auf spannende Begegnungen mit diesen unfreundlichen Tieren, die uns bislang nur aus dem „Portrait“ bekannt sind.
Warum ist es wichtig?
Der Fang und die Erforschung des Lua-Affen ist nicht nur aus rein biologischer Sicht interessant.
Jetzt, wo der endgültige Zusammenbruch des Kolonialismus naht und die Bastionen der jahrhundertealten Sklaverei der unterdrückten Völker zerbröckeln, verschmähen die Kolonialisten kein Mittel, um den mächtigen Aufschwung der nationalen Befreiungsbewegung in den Ländern Asiens, Afrikas zu ersticken und Amerika. Indem sie die Wissenschaft verfälschen, versuchen die Ideologen des Kolonialismus und die Prediger des tollwütigsten Rassismus, ihre räuberischen Pläne in den Augen der öffentlichen Meinung mit Hilfe von weit hergeholten "Theorien" zu rechtfertigen.
Die reaktionärsten bürgerlichen Wissenschaftler haben zahlreiche Hypothesen über Ologenismus, Polygenismus, Dichotomismus und ähnliche Erfindungen aufgestellt. Ihre Autoren sind unterschiedlich, aber das Ziel ist das gleiche - den Anschein von Beweisen zu erwecken, dass eine Person angeblich von verschiedenen Vorfahren abstammt. Moderne Völker, die verschiedene Kontinente und Inseln bewohnen, sind keine Blutsbrüder und Ursprünge, wie die Wissenschaft seit langem feststellt, sondern, sehen Sie, völlig unterschiedliche Arten und sogar angebliche Gattungen von Lebewesen. Unterschiedliche Herkunft impliziert offensichtlich unterschiedliche Fähigkeiten. Daher, so die Rassisten, werden einige Völker, die höheren, von der Natur selbst dazu berufen, die Erde zu beherrschen, während andere, die niedrigeren, aufgrund ihrer anfänglichen Unterlegenheit zur Sklaverei und Auslöschung verurteilt sind.
Für die Verteidiger dieses kannibalischen Konzepts wäre der amerikanische Menschenaffe ein Fund von unschätzbarem Wert. Schließlich wurden in Amerika noch keine Spuren von Menschenaffen gefunden – weder heute noch in ferner Vergangenheit. Rassistische Theorien, dass Indianer von einheimischen Menschenaffen abstammen, liegen in der Luft. Reaktionäre Anthropologen nutzen schon seit langem jeden Vorwand und erfinden alle möglichen amerikanischen Affen und "Pithecanthropes", um diese Lücke in ihren Erfindungen zu füllen. Der Fall des Lua-Affen ist nicht der einzige.
Der skandalöse Vorfall mit einem anderen amerikanischen "Anthropoiden" ereignete sich sogar noch früher, im Jahr 1922. In den alten Schichten des Landes Wyoming (ein Bundesstaat im Westen der Vereinigten Staaten) wurde ein Backenzahn eines fossilen Menschenaffen gefunden - so definierten zumindest die größten amerikanischen Paläontologen diesen Fund. Es war eine grandiose Sensation, die die gesamte wissenschaftliche Welt erschütterte. Das „primitive Mitglied der menschlichen Familie“, wie einige amerikanische Zoologen den hypothetischen Besitzer des Zahns nannten, hieß Hesperopithecus. Der deutsche reaktionäre Wissenschaftler Franz Koch beeilte sich, Hesperopithecus als Vorfahren der arischen Rasse zu registrieren, die natürlich einen besonderen Ursprung haben muss.
Aber wie erwartet haben gründlichere Studien gezeigt, dass der berüchtigte Zahn nicht zu einem Menschenaffen gehört, sondern ... zu einem wilden fossilen Schwein aus der Gattung Prostenops (Schweine- und menschliche Backenzähne sind sich sehr ähnlich).
Was für ein Skandal! „Bei den Vorfahren der arischen Rasse“, schreibt Professor M. F. Nesturkh, „gab es ein fossiles nordamerikanisches Schwein.“
Aber die Lektion kam nicht den Scharlatanen aus der Wissenschaft zugute. Sieben Jahre nach Hesperopithecus wurden der "Ameranthropoid Lua" und seine modifizierte Version im Werk von Courteville erfunden. Es wird offensichtlich andere Fälschungen geben.
Es besteht jedoch kein Zweifel, dass weder der Lua-Affe noch andere fälschlicherweise als amerikanische „Anthropoide“ bezeichnete amerikanische „Anthropoide“ wie Hesperopithecus oder der Homunculus des argentinischen Paläontologen Ameghino tatsächlich zu den Menschenaffen gehören. Es kann als erwiesen angesehen werden, dass die Vorfahren der Indianer vor relativ kurzer Zeit, vor ungefähr 25.000 Jahren, von Asien über die Landenge, die die Tschuktschen-Halbinsel und Alaska während der Eiszeit verband, nach Amerika gezogen sind. In Amerika gab es kein unabhängiges Zentrum menschlichen Ursprungs.
Es ist möglich, dass in derselben ereignisreichen Ära nach Menschen, Bisonherden und Mammuts ein weiteres mysteriöses Wesen von Asien nach Amerika zog - der Bruder des Bigfoot.
Hier ist, was sie über ihn sagen.
"Kobold" von Arroyo Bluff
27. August 1958 Gerald Crewe machte sich für die Arbeit fertig. Er arbeitete als Traktorfahrer beim Bau einer neuen Autobahn im Humboldt County (im äußersten Nordwesten Kaliforniens).
Sein Weg führte durch das Tal von Arroyo Bluff. Rundherum war ein wildes, unbewohntes Gebiet - felsige Seifen und Nadelwälder an den Hängen der Berge.
Nachdem er sich im Fluss gewaschen hatte, in dessen Nähe sich das Bauarbeiterlager befand, ging J. Crew zu seinem Traktor und blieb plötzlich stehen.
Trotzdem - immerhin stolperte er über die Spuren von ... einem "Schneemann", der, wie man so sagt, im Schnee des Himalaya umherwandert!
Aber Kalifornien ist hier - ein Land der modischen Resorts, Orangenplantagen und der größten Filmstudios der Welt ...
Als Gerald Crew wieder zur Besinnung kam, maß er die Abdrücke riesiger nackter Füße, die eine unbekannte Kreatur auf Lehmboden hinterlassen hatte. Vierzig Zentimeter - die Länge des Fußes! Und die Schrittlänge beträgt 115-175 Zentimeter.
Der Traktorfahrer wagte es, der Spur ein Stück weit zu folgen. Die Gleise führten fast von einem steilen Abhang herunter (ca. 80°!), führten um die Arbeitersiedlung herum und verschwanden im Wald hinter dem Hügel.
J. Crew hatte zuvor von seinen Kameraden von denselben seltsamen und riesigen Fußabdrücken gehört, die an den Ufern des Mad River (der nördlich von Humboldt Bay in den Pazifischen Ozean mündet) gesehen wurden.
Im September 1958 tauchte die mysteriöse Kreatur in der Nähe des Arbeiterlagers wieder auf. Die Frau eines der Handwerker schrieb einen Brief an die Lokalzeitung The Humboldt Times:
„Es gibt Gerüchte unter den Arbeitern, dass der Mann der Wälder existiert. Was hast du davon gehört?"
Der Brief wurde in der Zeitung abgedruckt. Die Herausgeber begannen, Briefe von anderen Lesern zu erhalten. Viele von ihnen behaupteten, sie hätten den „Paton“ – so wurde der struppige Riese hier genannt – mit eigenen Augen gesehen.
Zu diesem Zeitpunkt stieß J. Crew erneut auf mysteriöse Fußabdrücke im Tal von Arroyo Bluff und fertigte Gipsabdrücke davon an. Die Humboldt Times platzierte Fotografien dieser Abgüsse auf der Titelseite. Das Material wurde von anderen Zeitungen nachgedruckt. Aus aller Welt regnete ein Hagel von Briefen, Telegrammen, Fragen.
Wissenschaftler interessierten sich auch für seltsame Ereignisse. Der amerikanische Zoologe und Paläontologe Ivan Sanderson traf am Tatort ein. Er befragte Augenzeugen, untersuchte die Gipsabdrücke und fand eine Reihe neuer interessanter Umstände heraus. Über die gesammelten Informationen berichtete er in mehreren Artikeln. Eine davon wurde in der kubanischen Zeitschrift „Boemia“ (in der ersten Ausgabe von 1960) veröffentlicht.
Hier ist, was Ivan Sanderson festgestellt hat.
Der Unternehmer, der den Auftrag für den Bau der Autobahn erhielt, dachte zunächst, dass einer der Anwohner die Arbeiter einschüchterte, um den Bau der Straße zu stören. Dieser Betrüger besaß jedoch anscheinend übermenschliche Kräfte. Er nahm zum Beispiel ein Stahlfass mit Dieselkraftstoff mit einem Fassungsvermögen von 250 Litern aus einem Lagerhaus und warf es in eine abgelegene Schlucht. Dann schleppte er ein Stahlrohr und ein Rad von einem Bagger in den Wald. Ray Wallace, ein Unternehmer, stellte zwei Detektive ein. Sie mussten den Eindringling aufspüren und fangen.
Im Glauben, dass Zeit Geld ist, holten Ray Kerr und Bob Briton Bluthunde und begannen sofort mit der Suche. Aber die Aufgabe erwies sich als nicht so einfach, und die Detektive begannen ernsthaft zu glauben, dass sie viel mehr Zeit als Geld haben würden, wenn ihre Angelegenheiten so weitergingen.
Aber dann, eines Tages im Oktober 1959, kehrten nach Sonnenuntergang zwei Sherlock Holmes von einem weiteren Suchangriff zurück.
Plötzlich bemerkten sie am Rand der Forststraße ein struppiges humanoides Wesen. Es war "patenieren"! Mit zwei Sprüngen sprang er über die Straße und verschwand im Gebüsch.

Die Hunde, mit denen die Ermittler ihm folgen wollten, sind verschwunden. Sie sagen, dass sie ihre angenagten Knochen später im Wald gefunden haben.
Es wird weiter gesagt, dass ein Ehepaar mit seinem eigenen Flugzeug über dieses Gebiet geflogen ist. In den Bergen lag noch Schnee. Das Paar, obwohl sie miteinander beschäftigt waren, bemerkte jedoch unten etwas: einen riesigen, struppigen Riesen, der barfuß im Schnee lief und eine lange Reihe von Fußspuren hinter sich ließ.
Eine Dame und ihre Tochter trafen zwei Patons im Hupa-Tal. Und im August 1959 sahen zwei Anwohner 23 Meilen nördlich der neuen Autobahn erneut Spuren von Monstern. Sie fanden sogar ihre Wolle, die in Büscheln an den Zweigen von Tannen und an der Rinde von Kiefern in einer Höhe von etwa zwei Metern über dem Boden klebte. Die Länge der Haare war unterschiedlich - von 2 bis 27 Zentimeter.
Unter den Bäumen fanden sie das Versteck des Patons, wo er die Nacht verbrachte. Es wurde aus Moos und Zweigen gebaut. Paton entfernte Moos und Flechten von Bäumen.
Betty Allen, Korrespondentin der Humboldt Times, sprach mit einheimischen Indianern.
Heiliger Gott! Sie waren überrascht. „Lassen Sie die Weißen endlich davon erfahren!“
Früher gab es an diesen Orten mehr Patons. Es wird gesagt, dass sie einmal angeblich sogar ein Bergbaudorf in der Nähe des Clear River (südwestliches Oregon) angegriffen, ein Lagerhaus mit Lebensmittelvorräten verwüstet und drei Arbeiter getötet haben sollen. Während des Goldrausches von 1848-1849 vernichteten Massen von Abenteurern, die nach Kalifornien kamen, viele Patons und trieben sie in die fernen Wälder. Nur sehr wenige von ihnen überlebten.
Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus diesen Berichten ziehen? fragt Ivan Sanderson.
Die Zeit ist vorbei, in der Zoologen einstimmig eine fantastische haarige Gestalt verspotteten, die unerwartet auf den eisigen Gipfeln des Himalaya auftauchte, wie ein Geist aus der fernen Vergangenheit unseres Planeten.
Seltsame Berichte über alle möglichen "wilden Menschen" kommen jetzt von den unerwartetsten Orten - aus Malaya, Indonesien, Nordwestchina, aus der Mongolei, aus dem Pamir, aus Transbaikalien, sogar aus dem Kaukasus und schließlich aus Kalifornien.
Die Wissenschaftler, die diesem hochinteressanten Problem nachgegangen sind, haben sogar in der antiken Literatur und in mittelalterlichen Manuskripten Westeuropas „Spuren“ des wilden Mannes gefunden.
Es scheint, dass diese angeblichen Menschenaffen erst vor kurzem, vor etwa 400-500 Jahren, sehr weit verbreitet waren. Die Erfindung der Feuerwaffen markierte den Beginn ihrer Massenvernichtung.
Es ist möglich, dass die Geschichten über verschiedene Arten von Almesty, Almas und Kaptar, die von den Bewohnern des Kaukasus, Zentralasiens und der Mongolei zu hören sind, verspätete Erinnerungen an vergangene Zeiten sind, als diese „Kobolde“ aus Fleisch und Blut Seite lebten an der Seite des Menschen.
Es ist auch möglich, dass sie in einigen abgelegenen Ecken bis heute überlebt haben. Nordwestkalifornien und Südwestoregon sind einer der möglichen Lebensräume für diese unbekannten Kreaturen, die während der Eiszeit aus Asien hierher gezogen sein könnten, da in Amerika keine anthropoiden Fossilien gefunden wurden.
„In der Nähe von Arroyo Bluff“, schreibt Ivan Sanderson, „gehen sicherlich seltsame Dinge vor. Eine mysteriöse Kreatur schafft es, Stahlfässer mit Öl, Eisenrohre und Räder von Ort zu Ort zu bewegen. Er erklimmt mühelos steile Hänge, knurrt laut und hinterlässt vierzig Zentimeter lange Spuren.
Es besteht kein Zweifel, dass diese Spuren wirklich existieren. Sie wurden von keinem Betrüger fabriziert: Es gibt ziemlich starke Beweise dagegen.
Der äußerste Nordwesten Kaliforniens erstreckt sich über mehr als 100 Quadratmeilen. Bis vor kurzem war dieses Gebiet unbewohnt. Das Gebiet ist mit dichten und undurchdringlichen Wäldern bedeckt und für die Luftbeobachtung nicht zugänglich (mit Ausnahme der höchsten Berggipfel).
Diese Orte wurden von niemandem erforscht. Nicht einmal detaillierte Karten wurden erstellt. Im Zentrum der Zivilisation gibt es einen völlig wilden Ort und wahrscheinlich lebt dort eine unbekannte und mysteriöse Kreatur.
Allerdings stimmen nicht alle amerikanischen Zoologen der Meinung von Ivan Sanderson zu, dass "es genügend Beweise dafür gibt", dass die Paton-Spuren nicht von einem Betrüger fabriziert wurden.
Ich habe gerade einen Brief vom American Museum of Natural History von Dr. Joseph Moore vor mir, der schreibt, dass er und seine Kollegen die Berichte von Arroyo Bluff Bigfoot mit großer Skepsis prüfen.
Materialien, die das Museum aus Kalifornien erhalten hat, liefern "ausreichend starke Beweise nur dafür, dass dies nichts weiter als ein Witz ist, und wir sehen vorerst davon ab, darüber zu diskutieren".

Trotzdem entschied sich Tom Slick, der Organisator der amerikanischen Himalaya-Yeti-Expeditionen, sein Glück in Kalifornien zu versuchen. Kürzlich war er in Moskau und sagte, er habe Spezialisten zur Aufklärung nach Arroyo Bluff geschickt.
Agogwe - "Schneemänner" Afrikas
Eines der ungelösten Geheimnisse der afrikanischen Wildnis, schreibt der britische Naturforscher Frank Lane, sind kleine Wald-„Männer“ – Agogwe.
Seltsame Kreaturen sind nicht größer als vier Fuß (etwa 1 Meter 20 Zentimeter), ihr ganzer Körper ist mit roten Haaren bedeckt, ihr Gesicht ist ein Affe, aber sie gehen auf zwei Beinen wie Menschen.
Agogwe leben in den Tiefen undurchdringlicher Wälder. Selbst ein erfahrener Jäger hat kaum eine Chance, sie zu sehen. Das passiert nur einmal im Leben, sagen Einheimische. Gerüchte über Aggwe verbreiteten sich über ein Gebiet von mehr als 1000 Kilometern – vom Südwesten Kenias bis nach Tanganjika und weiter bis nach Mosambik.
Auch europäische Reisende berichten von kleinen Wald-„Männern“. Kapitän Hichens, ein Beamter der britischen Verwaltung in Kenia, sammelte während eines langen Dienstes in Afrika viele Informationen über die mysteriösen, der Wissenschaft unbekannten Tiere, an deren Existenz die Einheimischen glauben. In dem 1937 in der englischen Wissenschaftszeitschrift „Discovery“ („Discovery“) veröffentlichten Artikel „African Mysterious Animals“ schreibt er über Agogwe:
„Vor einigen Jahren erhielt ich einen Jagdauftrag, um einen menschenfressenden Löwen in den Wäldern von Issur und Simbiti am westlichen Rand der Vembara-Ebene zu erlegen. Als ich einmal auf einer Waldlichtung im Hinterhalt auf einen Kannibalen wartete, kamen plötzlich zwei kleine braune Kreaturen aus dem Wald und versteckten sich in einem Dickicht auf der anderen Seite der Lichtung. Sie sahen aus wie winzige Männer von etwa vier Fuß Höhe, gingen auf zwei Beinen und waren mit roten Haaren bedeckt. Der einheimische Jäger, der mich begleitete, erstarrte überrascht mit offenem Mund.
Das ist Aggwe“, sagte er, als er ein wenig zur Besinnung kam.
Hichens verbrachte viel Zeit damit, die kleinen "Männer" wiederzusehen. Aber es ist leichter, eine Nadel im Heuhaufen zu finden als ein flinkes Tier in diesem unwegsamen Dickicht!
Hichens versichert, dass die Kreaturen, die er sah, nicht wie die Affen waren, die er kannte. Aber wer sind sie?
Einige Jahre zuvor veröffentlichte das Journal of the Natural Science Society of East Africa and Uganda den folgenden Bericht: „Die Eingeborenen der Region Kwa Ngombe behaupten, dass ihre Berge von Büffeln, Wildschweinen und einem Stamm kleiner roter „Männer“ bewohnt werden. die eifersüchtig ihren Bergbesitz bewachen. Der alte Salim, ein Führer aus Embu, sagte, er sei einmal mit ein paar Gefährten hoch in die Berge geklettert. Wir erreichten fast den Gipfel, hier wehte ein kalter Wind. Plötzlich regnete ein ganzer Steinhagel von oben auf die Jäger nieder. Sie nahmen Reißaus. Als er zurückblickte, sah der alte Salim zwei Dutzend kleine rothaarige „Männer“, die von der Spitze einer steilen Klippe Steine auf sie warfen.
Hier sind weitere Geschichten über die kleinen rothaarigen „Männer“ Afrikas.
Ein Reisender sah sie von einem Schiff aus, das vor der Küste Mosambiks in Begleitung von Pavianen segelte. Ein anderer begegnete in den Tiefen desselben Landes einer ganzen Agogwe-Familie: Mutter, Vater und Jungtier. Die ihn begleitenden einheimischen Jäger protestierten heftig, als er einen der Liliputaner erschießen wollte.
Hast du gehört, - fragte sein Knappe den Jäger Kotney, - von den kleinen Männern, die am Mai leben? Über kleine Leute, die eher wie Affen als wie Menschen sind?
Und er erzählte, wie sein Vater einst von den „Zwergen“ des Mai gefangen genommen wurde, als er an den Hängen des Mount Longonot Schafe hütete. Er verfehlte ein Schaf und folgte seiner blutigen Spur. Plötzlich, aus dem Nichts, umgaben ihn seltsame kleine Kreaturen, kleiner als die „Waldmenschen“ (dh Pygmäen), sie hatten keine Schwänze, aber sie sahen eher aus wie Affen, die durch Bäume springen, als wie Menschen. Ihre Haut ist so weiß wie der Bauch einer Eidechse, aber ihr Gesicht und ihr Körper sind mit langen schwarzen Haaren überwuchert.
Mit Hilfe seines Speers beseitigte der Hirte die gefährliche Gesellschaft militanter „Zwerge“.
Das Auffälligste ist, dass die kleinen Wald-Männer, wie sie Gerüchte zeichnen, sehr an ausgestorbene Affen erinnern, die Paläontologen wohlbekannt sind ...
Vor 500-800.000 Jahren lebten kleine haarige "Männer" wirklich in den Ebenen Südafrikas. In kleinen Gruppen zogen sie durch die Flusstäler, jagten Hasen, Paviane und sogar Antilopen, die von der ganzen „Gesellschaft“ zusammengetrieben wurden. Paviane und Antilopen wurden von haarigen „Männchen“ getötet, indem ihnen mit scharfen Steinen der Schädel eingeschlagen wurde.
1924 fanden Kalksteinarbeiter in der östlichen Kalahari den versteinerten Schädel eines dieser prähistorischen Affen. Seitdem haben Anthropologen Dutzende ihrer Schädel, Zähne und Knochen untersucht.
Der südafrikanische Biologe Raymond Dart nannte die fossilen „kleinen Männer“ Australopithecus („südliche Affen“), nachdem er den ersten Fund aus der Kalahari untersucht hatte. Sie waren erstaunliche Affen! Sie lebten auf dem Boden, gingen nur auf zwei Beinen und hatten fast menschliche Körperproportionen.
Ihre Zähne waren mehr Menschen als Affen. Selbst in Bezug auf die Gehirngröße waren sie Menschen näher als Affen. Bei einem fünfjährigen Australopithecus-Jungtier betrug die Schädelkapazität 420 und bei einem erwachsenen Australopithecus 500-600 Kubikzentimeter - fast doppelt so viel wie bei einem Schimpansen und nicht weniger als bei einem Gorilla! Aber Australopithecus waren viel kleiner als diese Affen. Ihr Wachstum überschritt durchschnittlich 120 Zentimeter nicht und ihr Gewicht - 40-50 Kilogramm.
Einige Wissenschaftler vermuten sogar, dass Australopithecus sprach und wusste, wie man Feuer benutzt. Daher betrachten sie sie als die ältesten Vorfahren des Menschen.
„Aber“, schreibt M. F. Nesturkh, „es gibt keine Fakten, die für eine solche Annahme sprechen. Es gibt keinen Grund“, sagt er, „diese Affen als unsere Vorfahren zu betrachten.“
Sind Australopithecinen wirklich ausgestorben, fragen einige romantische Zoologen? Vielleicht verdanken die Gerüchte über die „Mai-Zwerge“, über die Wald-Männchen Agogwe ihren Ursprung dem Australopithecus, der in der Wildnis der Urwälder überlebte? Verfolgt von ihren stärkeren und weiter entwickelten „Vettern“ – den Menschen der Steinzeit, konnten sie sich vor ihrer Verfolgung im undurchdringlichen Dickicht und auf den Gipfeln der Berge verstecken, die in Afrika völlig unbewohnt sind und selten von Menschen besucht werden: es ist zu kalt für einen Afrikaner. Immerhin passierte anscheinend etwas Ähnliches mit dem Bigfoot in Asien.

Leopardenhyäne, eselgroße Katze und Beuteltiger
Wolf oder Mischling
Raubtiere sind den Menschen besser bekannt und besser untersucht als Affen. Schließlich musste ein Mensch oft gegen Raubtiere kämpfen und sein Vieh und sein Leben vor ihren Angriffen schützen. Wohl oder übel studierte er seine Feinde gut.
Rinderzüchter und Jäger aller Länder kennen die Gewohnheiten der Raubtiere ihrer Heimat. Daher sind es Raubtiere, die am schwierigsten der Aufmerksamkeit von Naturforschern entkommen. Und doch erwarten Zoologen auch in der Welt der Raubtiere manchmal Überraschungen.
Eine der neuesten „Überraschungen“ ist ein Bergwolf aus den südamerikanischen Kordilleren. Die Geschichte seiner Entdeckung ist voll von unerwarteten Entdeckungen und bitteren Enttäuschungen.
1927 kaufte der Direktor des Hamburger Zoos, Lorenz Hagenbeck, der Sohn und Nachfolger des Werks von Karl Hagenbeck, das Fell eines unbekannten Wolfs in Buenos Aires. Der Mann, der es verkaufte, sagte, es sei ein "Bergwolf", der hoch oben in der Kordillere getötet wurde. Keiner der Experten konnte feststellen, zu welchem Tier diese Haut tatsächlich gehört. Sie reiste lange von einem Museum in Deutschland zum anderen und landete schließlich in München.
Nach 14 Jahren wurde sie hier von einem großen Säugetierkenner, Dr. Krumbigel, gesehen. Nach langem Überlegen kam er zu dem Schluss, dass die Haut offenbar zu einer Art Gebirgssorte des Mähnenwolfs gehörte. Der Mähnenwolf lebt in den Wüstenebenen von Paraguay, Bolivien, Nordargentinien und Südbrasilien. Es wurde auch vor relativ kurzer Zeit entdeckt und ist immer noch wenig verstanden. Es hat sehr lange Beine und Ohren und eine kleine Mähne wächst auf dem Genick und auf dem Rücken. Es ist bekannt, dass der Mähnenwolf nachts hauptsächlich auf verschiedene Kleintiere jagt, er ernährt sich auch von Früchten.

Das Fell eines unbekannten Tieres, das Hagenbeck nach Krumbiegel-Forschungen mitbrachte, wurde unter dem Namen „Mähnenwolf-Bergrasse“ in den Katalog des Münchner Museums aufgenommen.
Einige Jahre später war Hagenbeck wieder in Argentinien. Auf irgendeinem Markt sah er drei weitere der gleichen Felle; aber für seltene Felle verlangten sie zu viel, und er kaufte sie nicht.
Etwa zur gleichen Zeit erinnerte sich Dr. Krumbigel beim Durchsehen seiner alten Notizen daran, dass er in einer der Sammlungen südamerikanischer Säugetiere irgendwie den Schädel eines Wolfs gefunden hatte, der sich von allen der Wissenschaft bekannten Arten unterschied. Eine alte Arbeit, die die Zeichen eines seltsamen Schädels beschreibt, die der Wissenschaftler in seinem Archiv fand, machte ihn sehr glücklich. Ihm wurde klar, dass er aus dem Münchener Museum endlich den Schlüssel zur Lösung des Geheimnisses der unglückseligen Haut erhalten hatte, das, wie er selbst sehr gut wusste, von ihm ungenau bestimmt worden war.

1949 veröffentlichte Krumbigel einen Aufsatz, in dem er über die Ergebnisse seiner Forschung berichtete: Schädel und Haut gehören einem Tier einer besonderen Art und Gattung an. Er nannte es Dasycyon hagenbecki. Dazition steht dem Mähnenwolf nahe, obwohl er sich stark von ihm unterscheidet. Es ist größer (die Länge der Haut mit einem Schwanz beträgt zwei Meter), gedrungener und stämmiger, mit kurzen Beinen. Es hat kleine abgerundete Ohren und ein sehr dickes und langes Fell. Auf dem Rücken erreichen die Haare eine Länge von zwanzig Zentimetern! Das Fell des Dazicyon ist dunkelbraun, das des Mähnenwolfs gelbrot, wie das unseres Fuchses. Der Mähnenwolf lebt in den offenen Ebenen, während die Dazition in den Bergen lebt.
Keiner der Europäer hat diese Bestie bisher gesehen, weder lebend noch tot. Er wurde in Teilen beschrieben und sozusagen der Wissenschaft "angehängt" - entsprechend der Haut und dem Schädel, die zu unterschiedlichen Zeiten nach Europa gebracht wurden.
In den letzten Jahren wurden jedoch Stimmen unter Fachleuten laut, die die wahre Existenz des von Krumbigel beschriebenen Wolfs leugneten. Auf solch „extravagante“ Weise geöffnet, ist das Biest ihrer Meinung nach einfach ein wilder Mischling. Im neusten Führer der südamerikanischen Säugetiere ("Catalogue of South American Mammals"), erschienen 1957, wird der Dasition nicht unter den wilden Bewohnern dieses Kontinents erwähnt. Ich schrieb mit der Bitte um Klärung an das Argentinische Museum für Naturgeschichte. Die Meinung von Prof. A. Cabrera war so, dass Hagenbecks Dazition kein Bergwolf war, sondern ein struppiger Wildhund, so etwas wie ein Scottish Shepherd Collie; zuerst fiel sie in die Hände der Schinder und dann ins Münchner Museum. Professor A. Cabrera ist der größte zeitgenössische Säugetierspezialist in Südamerika.
Aber Dr. Krumbigel ist auch ein weltberühmter Wissenschaftler. Er argumentiert, wenn er sich irren könnte, dann nur über die Herkunft der Haut, nicht aber des Schädels, der deutliche Zeichen trägt, die nichts mit der Hundegattung zu tun haben.
Leider ist es heute unmöglich, die Richtigkeit seiner Definition zu überprüfen: Die Haut des Dazition wird möglicherweise noch im Museum aufbewahrt, aber der Schädel ging während des Krieges verloren. Dieser Streit kann also nur von zukünftigen Forschern gelöst werden, die eine Trophäe von unschätzbarem Wert für die Wissenschaft wieder extrahieren müssen - den Schädel eines Cordillera-Bergwolfs oder ... eines wilden Mischlings aus den Slums von Buenos Aires.
Ende der kostenlosen Testversion.